
Während Kalten Krieges startete der US-Geheimdienst CIA die Operation Mockingbird, die darauf abzielte, die öffentliche Meinung durch Manipulation der Nachrichtenmedien zu beeinflussen.
Der berühmte US-amerikanische Watergate-Reporter Carl Bernstein deckte den Skandal 1977 auf. Was hat sich seither geändert? Das verrät Frank Schwede in einem Essay
Operation Mockingbird begann in den späten 1940er Jahren und endete Mitte der 1970er Jahre. Während dieser Zeit versuchte die CIA die Berichterstattung zu kontrollieren, indem sie Journalisten und Medienunternehmen als Werkzeug zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung einsetzte.
Eine Schlüsselfigur in dem Spiel ist ein gewisser Frank Wisner. Wisner wurde 1948 zum Direktor des Office of Special Projects (OSP) ernannt. Schon bald darauf wurde das OSP in Office of Policy Coordination (OPC) umbenannt, woraus schließlich die Spionage- und Spionageabwehrabteilung der CIA hervorging.
Kurze Zeit später wurde Wisner damit beauftragt, eine Organisation zu gründen, die sich auf Propaganda, Wirtschaftskrieg, präventive, direkte Aktionen, einschließlich Sabotage, Antisabotage, Abriss- und Evakuierungsmaßnahmen, Subversion gegen feindliche Staaten, einschließlich der Unterstützung von Untergrund-Widerstandsgruppen, ähnlicher der heutigen Antifa, einheimischer antikommunistischer Elemente in bedrohten Ländern der freien Welt konzentrieren sollte.
Im selben Jahr noch startete Wisner auch Mockingbird. Dazu rekrutierte er Philip Graham von der Washington Post, der das Projekt branchenintern leiten sollte. Nach 1953 wurde das Netzwerk von CIA-Direktor Allen W. Dulles übernommen
Zu diesem Zeitpunkt hatte Mockingbird bereits Einfluss auf 25 Zeitungen und Nachrichtenagenturen. Wisner versuchte unterdessen die Öffentlichkeit von den Gefahren des Kommunismus zu überzeugen. 1954 arrangierte er die Finanzierung der Hollywood-Produktion „Farm der Tiere“, eine Zeichentrick-Allegorie nach dem gleichnamigen Roman von George Orwell.
Gleichzeitig untersagte Wisner Zeitungen die Berichterstattung über bestimmte Ereignisse. Beispielsweise die Pläne der CIA zum Sturz der Regierung im Iran und in Guatemala.
Die Kontrolle des Informationsflusses war aus Sicht der damaligen Regierung von entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit.
Deshalb unternahm die CIA große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass amerikanische und internationale Zielgruppen Informationen enthielten, die den Interessen der USA entsprachen.
Journalisten wurden eingeschüchtert
Nach seinem Ausscheiden bei der Washington Post im Jahr 1977 untersuchte Watergate-Reporter Carl Bernstein über einen Zeitraum von sechs Monaten das Verhältnis zwischen dem US-Geheimdienst CIA und der Presse während des Kalten Krieges.
Bernstein fand heraus, dass die CIA sogar Journalisten einschüchterte, damit sie ihre Botschaften verbreiteten. Seine Geschichte veröffentlichte er 1977 im Magazin Rolling Stone. Obwohl ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde – bestraft wurde niemand.
Im Gegenteil: Hochrangige CIA-Mitarbeiter, darunter die ehemaligen Direktoren William Colby und George Bush, überzeugten den Ausschuss, seine Untersuchungen einzuschränken und den tatsächlichen Umfang der Aktivitäten im Abschlussbericht bewusst falsch darzustellen.
Der mehrbändige Bericht enthält neun Seiten, auf denen der Einsatz von Journalisten bewusst vage und teilweise irreführend diskutiert wird. Die tatsächliche Zahl der Journalisten, die verdeckte Aufträge für die CIA entgegennahmen, wird mit keiner Zeile erwähnt. Auch die Rolle von Zeitungs- und Rundfunkmanagern bei der Zusammenarbeit mit der CIA wird nicht ausreichend beschrieben.
Manche Journalisten unterhielten stillschweigende, andere explizite Beziehungen zur CIA. Es war ein Spiel von Zusammenarbeit und Entgegenkommen. Reporter teilten ihr Notizbuch mit der CIA, Redakteure ihre Mitarbeiter. Unter den Journalisten waren sogar Pulitzer-Preisträger, also angesehene Reporter.
1976 erklärte CIA Direktor George H.W. Bush, dass die Agentur sich aus dem Nachrichtengeschäft zurückgezogen habe, aber weiter Freiwillige aufnehme, die ihrem Land helfen wollen.
Tatsächlich brach die CIA die Beziehungen zu den unproduktiven Journalisten ab, um den Anschein zu erwecken, sie würde ihre Reihen von Propagandisten säubern. Doch dies war in Wahrheit nur ein Deckmantel, um ihre Trüffelschweine aufrechtzuerhalten.
Es ist schließlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass bei jeder Untersuchung der Regierung durch die Regierung bestimmte Informationen zurückgehalten werden, dass aber gleichzeitig nach außen der Anschein einer gründlichen Arbeit erweckt wird. Sehr deutlich ist das anhand der 9/11-Kommssion zu erkennen. Das funktioniert immer.
Man muss ja nicht alles, was durch eine Untersuchung aufdeckt wird veröffentlichen, aber man muss zumindest nach außen kritisch sein. Verschleierung ist in diesem Fall das Mittel der Wahl – und: Eine kompromittierte Presse bestätigt die Zuverlässigkeit des von der Regierung produzierten Materials immer.
Die Einfluss von Geheimdiensten und NGOs ist weiter sehr hoch
Mockingbird hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die journalistischen Standards und natürlich auch auf das öffentliche Vertrauen in die Medien. Senator Frank Church argumentierte im Untersuchungsausschuss, dass die Fehlinformationen den amerikanischen Steuerzahlern schätzungsweise 265 Millionen US-Dollar pro Jahr kosteten.
Während der aktiven Phase beeinflussten die beteiligten Journalisten und Medienunternehmen ein breites Themenspektrum. Von der politischen Berichterstattung bis hin zu außenpolitischen Angelegenheiten – meistens ohne transparente Quellenangaben zu nennen.
Der geopolitische Hintergrund des Kalten Krieges kann bei der Diskussion über die Berechtigung und das Ausmaß der Operation nicht genug betont werden. Während die Nationen mit Spionage und Propaganda zu kämpfen hatten, wurde die Manipulation von Medienberichten als ein weiteres Schlachtfeld betrachtet.
Das Verständnis dieses historischen Kontexts gibt Aufschluss darüber, wie tief militärische und geheimdienstliche Strategien in die alltäglichen Medien integriert sein können.
Das führt uns zwangsläufig zu der Frage, ob Geheimdienste noch immer Einfluss auf die Berichterstattung in den Medien nehmen. Die Liste der Vorwürfe ist lang, über die anhaltende Medienmanipulation, die darauf hindeuten, dass diese Praktiken in unterschiedliche Form, heute vor allem über sogenannte Nichtregierungsorganisationen (NGOs), weiter fortbestehen.
Eine traurige Tatsache ist, dass die sogenannte Wahrheit aus Sicht der meisten westlichen Regierungen nicht sonderlich erwähnenswert ist, was zur Folge hat, dass die öffentlich rechtlichen Nachrichtenmedien lediglich als Instrument der Hegemonie eingesetzt werden.
Das geht unter anderem aus Whistleblower-Berichten und freigegebenen Dokumenten hervor, die veranschaulichen, wie bestimmte Medienberichte noch immer von Geheimdienstinteressen beeinflusst werden.
Der Einfluss von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen verwischen die Grenzen oft noch weiter und verkomplizieren das Bild. Vor allem große Medienunternehmen, deren Geschäftsinteressen sich mit denen politischer Akteure überschneiden, können ihre Narrative beabsichtigt auf die Ziele verschiedener Interessengruppen lenken.
Das hat vor allem in den letzten Jahren dazu geführt, dass Medienkonsumenten heute vorsichtiger sind. Es ist wichtiger denn je, die Mediennutzung zu diversifizieren, verschiedene Perspektiven einzubeziehen und die Motive hinter den Informationen zu hinterfragen, weil die Grenze zwischen seriösem Journalismus und staatlicher Einflussnahme zunehmend verschwimmt.
Nun auch soziale Medien im Fokus der Propaganda
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Debakel Anfang der 2000er Jahre um staatlich kontrollierte Informationen über Massenvernichtungswaffen im Irak. Damals schien es so, als ob keine alternativen Quellen die Angelegenheit untersuchten.
Trotz zunehmender Verdächtigungen dauerte es Jahre, bis eine umfassende Untersuchung durchgeführt wurde, die schließlich die traurige Wahrheit ans Licht brachte, dass es keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab, dass die Behauptung lediglich zur Rechtfertigung einer militärischen Intervention durch die USA geäußert wurde.
Solche Geschichte lassen vermuten, dass die Lehren aus Mockingbird weder verinnerlicht noch angewendet wurden. Die Medien werden seither nicht umsonst als inoffizielle vierte Gewalt der Regierung bezeichnet.
Wenn es nämlich darum geht, nicht die ganze Wahrheit zu sagen, sind Journalisten ebenso mitschuldig wie die Regierungen. Doch in den großen Medienhäusern wird das anders gesehen.
Katharine Graham, die Ehefrau von Phil Graham, die nach dessen Tod die Washington Post übernahm, sagte über die Geheimhaltung der Presse im Interesse der nationalen Sicherheit:
„Wir leben in einer schmutzigen und gefährlichen Welt. Manche Dinge müssen und sollten die Öffentlichkeit nicht wissen. Ich glaube, Demokratie blüht, wenn die Regierung legitime Schritte unternehmen kann, um ihre Geheimnisse zu wahren, und wenn die Presse selbst entscheiden kann, ob sie ihr Wissen veröffentlicht.“
Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Vor allem die öffentlich rechtlichen Medien halten Geschichten nicht aus Gründen der nationalen Sicherheit zurück. Sie verzerren, verfälschen, verheimlichen und täuschen oft auf Anweisung und Druck durch Regierungsvertreter oder NGOs, die teilweise schon einen größeren Einfluss haben als Regierungen selbst.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der perversen Beziehung zwischen Regierungen und der vierten Gewalt ist, dass Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen und Geheimdienste auf niedriger Ebene hochrangigen Journalisten häufig Material zuspielen, um etwa Regierungsvertreter dazu zu bringen, bestimmte Geschichten zu glauben, etwa beim Klimawandel.
Zumindest in den Vereinigten Staaten hat sich das Blatt mit Präsident Donald Trump offenbar gewendet, indem er CNN und seinesgleichen als Fake News angeprangert hat – doch man soll bekanntlich den Morgen nicht vor dem Abend loben.
Während sich also in den USA scheinbar der eiserne Griff kommerzieller Nachrichtenmedien auf die Köpfe der Bevölkerung abschwächt, scheint in den meisten europäischen Ländern genau das Gegenteil zu passieren.
In diesen Ländern glauben noch immer mehr als die Hälfte der Bevölkerung den Berichten der Konzernmedien und folgen ihnen aufs Wort. Heute ist es sogar noch einfach, den Informationsfluss in den Konzernmedien zu kontrollieren als während des Kalten Kriegs. Sechs Konzerne besitzen nämlich 90 Prozent der großen Medien.
Tatsache aber ist, glaubt man den Insiderinformationen, dass sich die gesamte Branche im Niedergang befindet und droht, bald in Vergessenheit zu geraten sobald die Babybommer nicht mehr da sind. Über diese Tatsache sind sich natürlich auch die Propagandisten im Klaren.
Seit langem schon verbreiten sie ihre Propaganda auch in den sozialen Medien, um die Öffentlichkeit weiter mit ihrem Müll zu verdummen. Blogs, YouTube-Kanäle und Podcasts erweisen sich als beliebte Plattform – lang lebe die Gehirnwäsche.
Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 18.08.2025




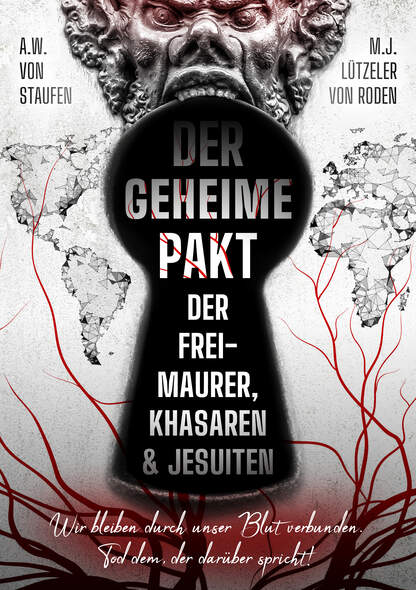


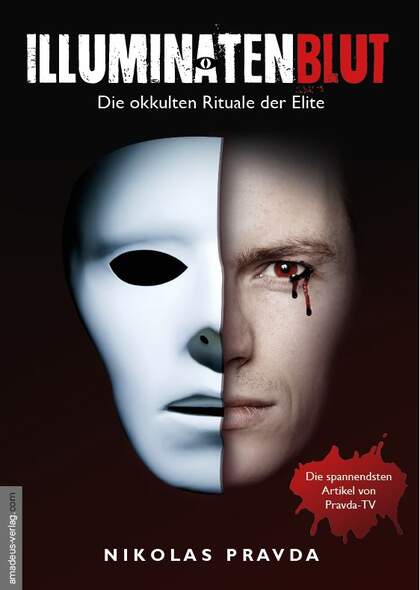
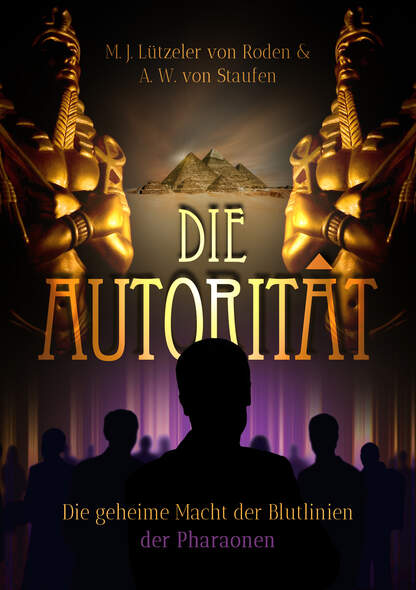
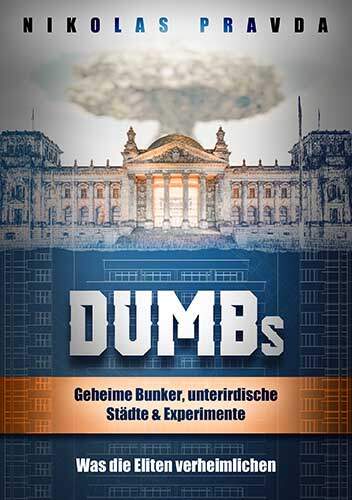
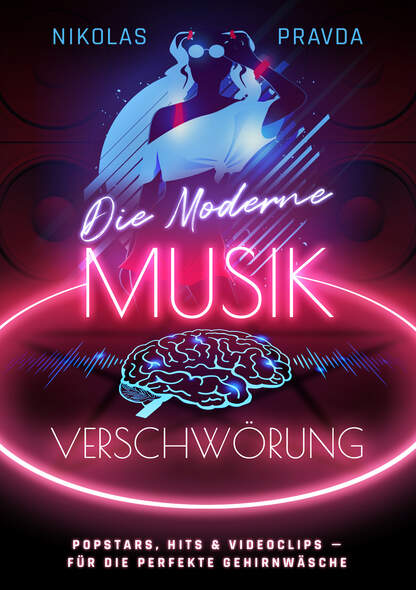
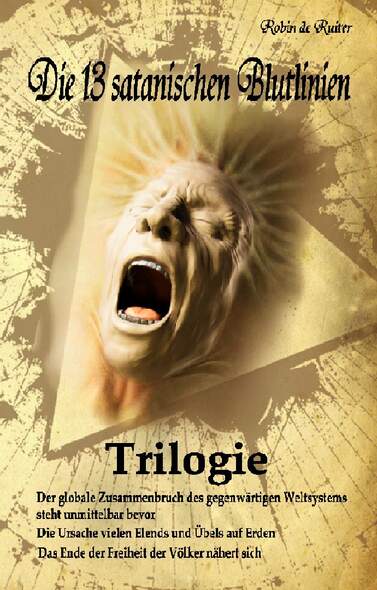
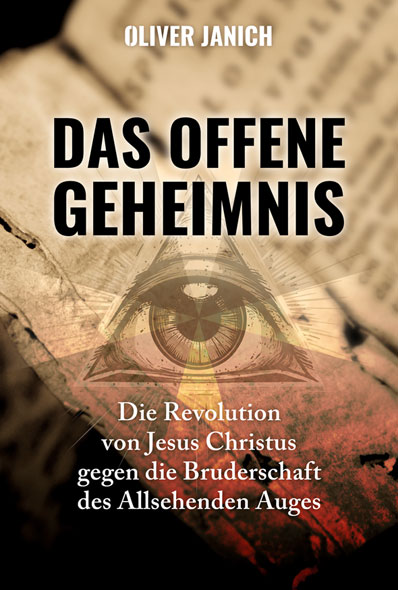
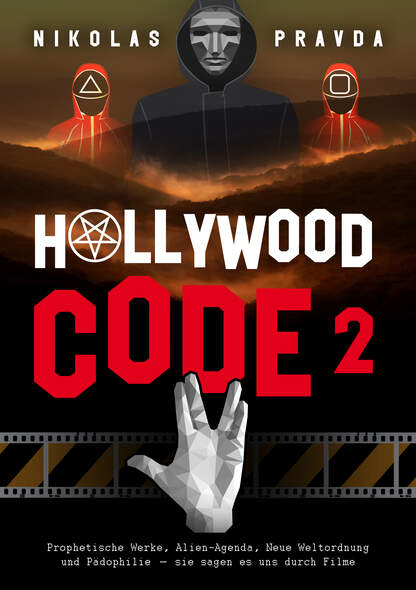

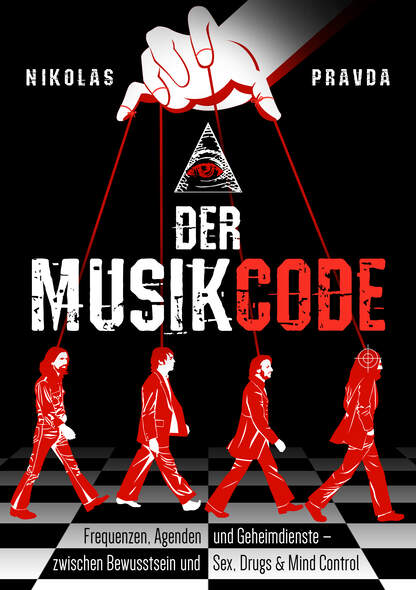
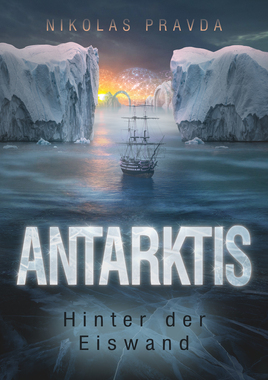
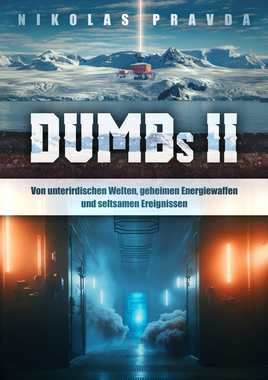

OPC arbeitete mit geringer Aufsicht durch die Regierung (das OPC war dem Secretary of State unterstellt und mit CIA-Personal besetzt) und ohne moralische Restriktionen. Viele der Rekruten waren ehemalige Nazis. 1952 verfügte das OPC über beinahe 3000 feste und ebenso viele freie Mitarbeiter in 47 Auslandsstationen.
Anfang der 50er Jahre ging die Organisation, welche mittlerweile den Zorn von Truman und von CIA-Direktor Bedell Smith auf sich gezogen hatte, in der CIA auf und wurde zu Department of Plans (DP), die Stellenbezeichnung des Abteilungsleiters lautet DDP. S. https://matrix169.wordpress.com/geschichte/wie-der-militaerisch-industrielle-komplex-den-kalten-krieg-gewann/
“Die Demokratie wurde vor dem Kommunismus gerettet, indem sie abgeschafft wurde”. Zitat Armin Wertz