
Die Geschichte von Jesu Kreuzigung – ein ebenso tragischer wie prägender Moment – gilt seit Jahrhunderten als spiritueller Eckpfeiler des christlichen Glaubens. Die kanonischen Evangelien schildern die bekannte Abfolge der Ereignisse: Jesus wird von Pilatus verurteilt, auf Golgatha gekreuzigt und am Kreuz von der Lanze eines römischen Soldaten durchbohrt.
Doch außerhalb des offiziellen Bibelkanons bewahren weniger bekannte Texte alternative Perspektiven, die schwierige Fragen aufwerfen und unerwartete Erkenntnisse bieten.
Dazu gehört das Nikodemusevangelium , ein Dokument, das im Neuen Testament nicht vorkommt, aber in der apokryphen Tradition erhalten bleibt. Es beansprucht den Namen des Soldaten, der Jesus durchbohrte, und interpretiert seine Rolle völlig neu.
Die darin genannte Figur – Longinus – wurde im Laufe der Zeit zu einem Symbol der Transformation und erscheint in der ostorthodoxen Ikonographie und später in der katholischen Verehrung sowohl als Zeuge als auch als Gläubiger.
Obwohl moderne Historiker seine Existenz nicht bestätigen können, lädt seine Geschichte zu einer tieferen Untersuchung der Art und Weise ein, wie spirituelle Wahrheiten nicht nur durch historische Aufzeichnungen, sondern auch durch Mythen, Symbole und kollektive Bedürfnisse vermittelt werden. Warum wurde dieser Text aus der Bibel weggelassen?
Was verrät seine Version der Ereignisse über das Ringen der frühen Christen um Macht, Gerechtigkeit und die Bedeutung der Begegnung mit Gott?
Der kanonische Bericht über den Tod Jesu – Heilige Schrift und Wissenschaft im Einklang
Der Tod Jesu Christi durch Kreuzigung ist eine der beständigsten Erzählungen der religiösen und historischen Tradition. Den Evangelien des Neuen Testaments zufolge wurde Jesus an einem Freitagnachmittag auf Golgatha vom römischen Statthalter Pontius Pilatus verurteilt und gekreuzigt. Dieses Ereignis soll traditionell am 3. April 33 n. Chr. stattgefunden haben, ein Datum, das mit Angaben in der christlichen Heiligen Schrift übereinstimmt und sogar durch astronomische Daten gestützt wird.
Die NASA hat festgestellt, dass an diesem Tag eine Mondfinsternis stattfand, und einige Wissenschaftler vermuten, dass dies die biblischen Hinweise auf die Blutverfärbung des Mondes erklären könnte – eine Ausdrucksweise, die oft als Beschreibung einer von Jerusalem aus sichtbaren Sonnenfinsternis interpretiert wird. Obwohl dies an sich kein historischer Beweis ist, zeigt es doch, wo sich religiöse Erzählungen und Naturphänomene überschneiden. (Jesus hieß eigentlich nicht Jesus – so wurde er wirklich genannt (Video))
Eine der medizinisch spezifischeren Stellen im Evangelium findet sich im Johannesevangelium (19:34). Dort wird beschrieben, wie ein römischer Soldat mit einem Speer in die Seite Jesu sticht, woraufhin Blut und Wasser herausfließen.
Dieses Detail faszinierte Wissenschaftler und Ärzte gleichermaßen, da das Austreten von Blut vermischt mit klarer Flüssigkeit auf einen Perikarderguss oder Pleuraerguss hindeuten könnte – Erkrankungen, die durch ein Trauma oder einen Herzriss verursacht werden.
Dieses körperliche Symptom, ob symbolisch oder wörtlich, wurde in theologischen Kreisen oft als Repräsentation der menschlichen und göttlichen Natur Christi interpretiert. Im traditionellen christlichen Denken war der Speerstoß nicht nur ein Akt der Grausamkeit, sondern ein Ereignis, das die Realität des Todes und das Mysterium der spirituellen Wiedergeburt betonte.
Trotz der Bedeutung dieser Tat wird die Identität des Soldaten, der den Speer schwang, in den kanonischen Evangelien nicht genannt. Die Figur bleibt in der Heiligen Schrift anonym, was Raum für Spekulationen und spätere Interpretationen lässt. In den Jahrhunderten nach der Entstehung des Christentums versuchten verschiedene Traditionen und nichtkanonische Texte, diese erzählerischen Lücken zu schließen.
Dazu gehört das Nikodemusevangelium, ein späteres Werk, das nicht in die Bibel aufgenommen wurde und eine eigene Version der Ereignisse bietet – einschließlich der Nennung des Soldaten. Bevor wir uns jedoch mit diesen alternativen Texten befassen, ist es wichtig zu erkennen, dass die traditionellen Evangelienberichte nach wie vor von zentraler Bedeutung für die christliche Theologie sind. Sie gründen nicht nur auf der religiösen Tradition, sondern auch auf einem historischen Kontext, der weiterhin mit modernen wissenschaftlichen Mitteln untersucht wird.
Das Evangelium des Nikodemus und des Soldaten namens Longinus
Das Nikodemusevangelium, auch bekannt als die Pilatusakten, weist eine bemerkenswerte Abweichung von den kanonischen Evangelien auf, indem es dem römischen Soldaten, der Jesu Seite durchbohrte, einen Namen zuweist. Diesem nichtkanonischen Text zufolge hieß der Mann Longinus.
Während das Johannesevangelium den Akt des Speerstechens erwähnt, ohne den Soldaten zu nennen, bietet das Nikodemusevangelium eine ausführlichere Darstellung – Longinus ist dort nicht nur der Vollstrecker dieser speziellen Tat, sondern auch Zeuge der übernatürlichen Ereignisse nach Jesu Tod. In einigen Versionen der Überlieferung wird ihm auch die Aussage zugeschrieben: „Wahrlich, dieser war Gottes Sohn“, eine Aussage, die in Matthäus 27:54 zu finden ist, obwohl das kanonische Evangelium den Sprecher nicht namentlich nennt.
Die Identifizierung des Longinus scheint sowohl eine erzählerische als auch eine theologische Funktion zu erfüllen, indem sie der römischen Präsenz bei der Kreuzigung ein menschliches Gesicht gibt und eine Figur schafft, durch die später Buße und Wandlung erforscht werden.
Trotz der Eindringlichkeit der Geschichte wird Longinus in den frühesten christlichen Schriften oder römischen Geschichtsquellen nicht erwähnt. Daher datieren Gelehrte das Nikodemusevangelium viel später in der Entwicklung der frühchristlichen Literatur – wahrscheinlich um das 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr.
Dieses späte Datum ist einer der Gründe, warum der Text von den frühen Kirchenbehörden nie kanonisiert wurde. Sein Ursprung bleibt unklar, obwohl er oft Nikodemus zugeschrieben wird, dem Pharisäer, der laut Johannesevangelium bei der Beerdigung Jesu half.
Unabhängig davon, ob diese Zuschreibung stichhaltig ist oder nicht, spiegelt der Text eine wachsende Tradition apokryphen Geschichtenerzählens wider, in der die Anhänger Jesu versuchten, die Evangelienberichte zu erweitern und zu personalisieren. Diese Texte wurden zu ihrer Zeit nicht unbedingt als ketzerisch angesehen, wurden aber letztendlich aufgrund von Zweifeln an der Urheberschaft, der historischen Genauigkeit und der theologischen Konsistenz aus dem formellen Kanon ausgeschlossen.
Obwohl es außerhalb religiöser Texte und Legenden keine historischen Belege für die Existenz von Longinus gibt, entwickelte seine Figur in der christlichen Tradition ein Eigenleben . Besonders in der orthodoxen Ostkirche wird Longinus als Heiliger und Märtyrer verehrt – er soll zum Christentum konvertiert sein, nachdem er Zeuge der Kreuzigung geworden war, und später das Evangelium bis zu seiner Hinrichtung gepredigt haben.
Statuen von ihm finden sich an einigen der heiligsten Stätten des Christentums, darunter im Petersdom in der Vatikanstadt, wo sein Abbild unter der Kuppel verewigt ist. Seine Geschichte, obwohl nicht überprüfbar, steht für eine allgemeinere Tendenz in der spirituellen Literatur, die Teilnehmer an heiligen Ereignissen zu vermenschlichen und sie in Symbole der Erlösung und des Glaubens zu verwandeln.
Für diejenigen, die das Evangelium des Nikodemus annehmen, ist Longinus nicht nur ein römischer Zenturio; er erinnert uns daran, dass selbst diejenigen, die sich an Gewalt mitschuldig machen, zu tieferen Wahrheiten erwachen können.
Warum das Nikodemusevangelium aus dem Kanon ausgeschlossen wurde
Das Nikodemusevangelium war einer von zahlreichen Texten, die in den frühen Jahrhunderten des Christentums kursierten und die in den kanonischen Evangelien beschriebenen Ereignisse erweitern oder erläutern sollten. Trotz seiner detaillierten Erzählung und theologischen Bedeutung für einige frühe Gemeinschaften wurde es nie in die offizielle Bibel aufgenommen.
Einer der Hauptgründe liegt in seinem Zeitpunkt: Die meisten Gelehrten datieren den Text auf das 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr., mehrere Jahrhunderte nach den Ereignissen, die er angeblich beschreibt. Zu dieser Zeit waren die grundlegenden Dokumente des christlichen Glaubens – die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes – bereits allgemein anerkannt und die Kriterien für die Aufnahme in den Kanon wurden zunehmend formalisiert.
Zu diesen Kriterien gehörten die apostolische Urheberschaft oder eine enge Verbindung zu einem Apostel, Übereinstimmung mit der bestehenden Lehre und weite Verbreitung in den frühen christlichen Gemeinden. Das Nikodemusevangelium erfüllte keines dieser Kriterien vollständig.
Was die Urheberschaft betrifft, so wird der Text zwar Nikodemus zugeschrieben – der gleichen Person aus dem Johannesevangelium, die Jesus nachts besuchte und bei seiner Beerdigung half –, doch gibt es keine glaubwürdigen historischen Beweise, die ihn mit der Abfassung des Textes in Verbindung bringen. Pseudonyme Texte waren in der antiken religiösen Literatur keine Seltenheit, doch für Kirchenführer, die versuchten, die Orthodoxie zu definieren, weckten solche Ungewissheiten Zweifel.
Darüber hinaus enthält der theologische Inhalt des Nikodemusevangeliums, obwohl nicht offen ketzerisch, übernatürliche und dramatisierte Elemente, die sich in Ton und Struktur von den zurückhaltenderen Erzählungen der kanonischen Texte unterscheiden.
Dazu gehören ausführliche Dialoge in der Unterwelt, Beschreibungen von Jesu Abstieg in die Unterwelt und detaillierte Aussagen vermeintlicher römischer Zeugen. Diese Ergänzungen waren zwar fesselnd, wurden aber eher als Ausschmückungen denn als zuverlässige historische oder spirituelle Quellen angesehen.
Der Ausschluss solcher Texte war Teil der umfassenden Bemühungen der frühen Kirchenbehörden, die Kohärenz und Autorität der christlichen Lehre zu schützen. Mit der Ausbreitung und Diversifizierung des Christentums verschärften sich die theologischen Streitigkeiten, und die Notwendigkeit eines standardisierten Textbestands wurde dringlicher. Konzile wie jene in Karthago und Hippo im späten 4. Jahrhundert spielten eine bedeutende Rolle bei der Fertigstellung des späteren Neuen Testaments.
In diesem Zusammenhang blieb das Nikodemusevangelium – trotz seines Einflusses auf die mittelalterliche christliche Vorstellungswelt – außen vor. Sein Status als „apokryph“ bedeutete nicht, dass es wertlos war, aber er signalisierte, dass die Kirche es nicht als göttlich inspiriert oder lehrmäßig grundlegend anerkannte. Dennoch deutet die Tatsache, dass solche Texte weiterhin im Umlauf waren und Frömmigkeit inspirierten, auf eine Spannung zwischen institutioneller Autorität und der spirituellen Neugier der frühen Gläubigen hin – eine Dynamik, die religiöse Fragen bis heute prägt.
Longinus als Symbol – Vom Henker zum Heiligen
Obwohl die historische Existenz von Longinus nicht bestätigt werden kann, hat sich seine Präsenz in der christlichen Tradition weit über die eines namenlosen römischen Soldaten hinaus entwickelt. Im Laufe der Zeit wurde Longinus insbesondere in der ostorthodoxen und römisch-katholischen Tradition zu einer Symbolfigur, die Transformation und die Möglichkeit spirituellen Erwachens repräsentierte – selbst für diejenigen, die sich einst der Wahrheit widersetzten.
In diesen Traditionen wird er oft als römischer Zenturio dargestellt, der, nachdem er Jesu Seite durchbohrt und Zeuge der Kreuzigung geworden war, eine tiefgreifende Sinnesänderung erfährt. Der Satz „Wahrlich, dieser war Gottes Sohn“, der im Matthäusevangelium einem römischen Soldaten zugeschrieben wird, wird ihm in späteren Legenden rückwirkend zugeschrieben, obwohl der Sprecher im ursprünglichen Bibeltext anonym bleibt.
Diese Neuinterpretation ermöglichte es den frühen Christen, einem entscheidenden Moment der Passionsgeschichte eine persönliche Note zu verleihen, indem sie ihn einer Figur zuordneten, die sowohl Reue als auch Erlösung repräsentieren konnte.
Mit der Verbreitung der Legende um Longinus wuchs auch seine Heiligung. Im frühen Mittelalter wurde er als Heiliger Longinus verehrt, insbesondere in der Ostkirche, wo Geschichten über seine Bekehrung, seine Evangelisierung und sein Martyrium in den christlichen Gemeinden kursierten. Einige Überlieferungen behaupten, er sei hingerichtet worden, weil er das Evangelium predigte, zu einer Zeit, als das Christentum nach römischem Recht noch verboten war.
Obwohl es für diese Erzählungen keine nachweisbaren historischen Belege gibt, erlangten sie spirituellen Einfluss und trugen zu einer langen Tradition bei, in der Heilige oft nicht aufgrund strenger historischer Genauigkeit, sondern aufgrund der tieferen Wahrheiten, die ihre Geschichten vermittelten, verehrt wurden.
Statuen und Ikonen des Longinus finden sich in verschiedenen Kirchen und Kathedralen, vor allem im Petersdom im Vatikan, wo sein Abbild unter der Kuppel aufbewahrt wird – ein eindrucksvolles Symbol dafür, wie eine Figur außerhalb des biblischen Kanons im Herzen des institutionellen Christentums verehrt wurde.
Die Geschichte von Longinus veranschaulicht, wie Mythos und Erinnerung oft spirituellen Zwecken jenseits historischer Aufzeichnungen dienen. In ihm fanden Gläubige einen Spiegel ihrer eigenen inneren Reise – von Unwissenheit oder Mittäterschaft zu Bewusstsein und Hingabe. Seine Erzählung spiegelt ein wiederkehrendes Muster der Religionsgeschichte wider: die Verwandlung von Verfolgern in Propheten, von Außenseitern in Insider.
Ob Longinus jemals gelebt hat oder nicht, sein Vermächtnis bleibt als symbolische Brücke zwischen menschlicher Fehlbarkeit und göttlicher Möglichkeit bestehen. Er ist keine Figur der Gewissheit, sondern des Potenzials – und erinnert Gläubige daran, dass Einsicht in den unerwartetsten Momenten entstehen kann und dass Erwachen nicht nur den Rechtschaffenen vorbehalten ist.
Jenseits der Fakten – Spirituelle Erkenntnisse am Rande der Tradition
Die Geschichte des Longinus, ob wörtlich oder symbolisch verstanden, lädt zu einer umfassenderen Betrachtung des Wesens von Wahrheit, Offenbarung und spiritueller Transformation ein.
Im Kern spiegelt die anhaltende Faszination für Texte wie das Nikodemusevangelium einen tieferen menschlichen Instinkt wider: Sinn in den Lücken formaler Lehren zu suchen und zu erforschen, wie spirituelle Einsicht aus unwahrscheinlichen Quellen entstehen kann. Die Figur des Longinus – ein namenloser Soldat in der kanonischen Schrift, der in der apokryphen Tradition zum Heiligen wird – stellt mehr dar als nur die Neuinterpretation eines historischen Moments.
Er wird zu einer Linse, durch die wir untersuchen, wie sich Wahrheit im Laufe der Zeit entwickelt, geprägt nicht nur von schriftlichen Texten, sondern auch von innerer Erfahrung, gemeinschaftlichem Gedächtnis und der Sehnsucht nach Erlösung.
Spirituell gesehen ist Longinus nicht nur ein römischer Zenturio – er verkörpert jeden Menschen, der einer tiefen Wahrheit gegenübersteht und von ihr verändert wird. Seine Anwesenheit bei der Kreuzigung steht sinnbildlich für den Moment, den viele Suchende erleben: am Rande des Verstehens, unsicher, mitschuldig, und doch zur Wachsamkeit gerufen. Ob sein Speer den Leib Jesu durchbohrte oder nicht, seine Geschichte berührt das Bewusstsein derer, die mit überlieferten Glaubensvorstellungen und persönlicher Offenbarung ringen.
Das Wasser und das Blut, die aus Christi Seite flossen – medizinisch, symbolisch oder mystisch interpretiert – bieten eine Metapher für die duale Realität von Leiden und Gnade, dem Physischen und dem Transzendenten, die in einem einzigen Moment des Bruchs koexistieren. Dieser Moment des Bruchs wird paradoxerweise oft zum Beginn des Erwachens.
Wenn sich heilige Geschichten verändern oder neu überdacht werden, wie im Fall des Nikodemusevangeliums, untergraben sie nicht unbedingt den Glauben – sie vertiefen ihn. Sie erinnern uns daran, dass Wahrheit nicht immer im institutionellen Konsens verankert ist, sondern sich auch im Schweigen, im Mysterium und in den Stimmen offenbaren kann, die die Geschichte verdrängt hat.
Sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen bedeutet nicht, den Kanon abzulehnen, sondern zu erkennen, dass spirituelles Wachstum oft bedeutet, sich mit Einsicht in Mehrdeutigkeiten zu stellen.
In diesem Sinne stellt die Geschichte von Longinus keine Herausforderung der Kernbotschaft der Kreuzigung dar – sie ist eine Erweiterung davon. Sie erinnert uns daran, dass Klarheit nicht durch Gewissheit, sondern durch den Mut zum Rückblick entstehen kann.
Video:
Quellen: PublicDomain/spiritsciencecentral.com am 07.09.2025




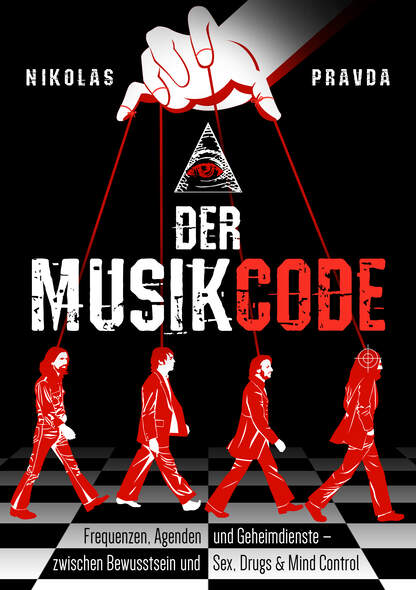
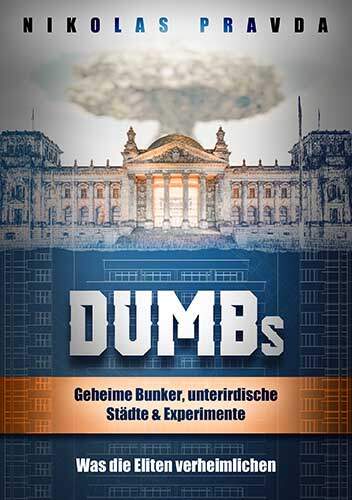

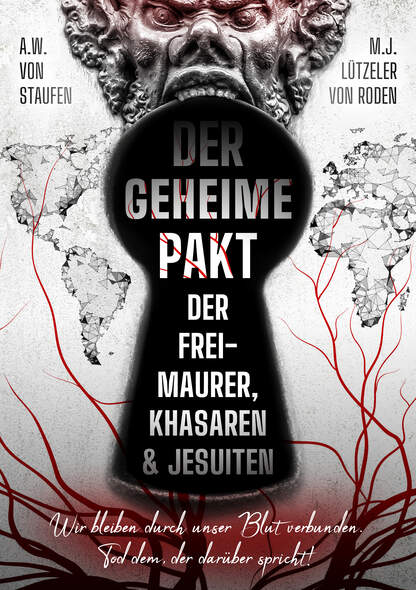

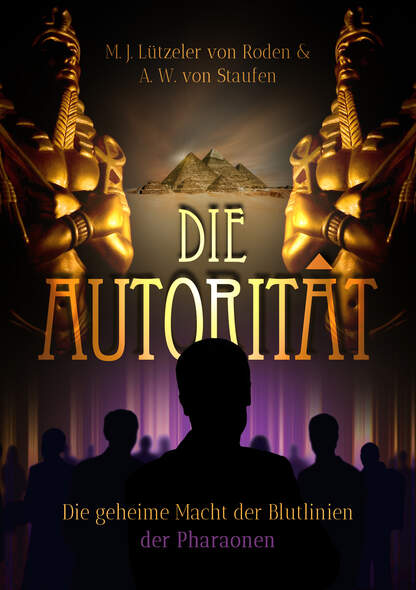
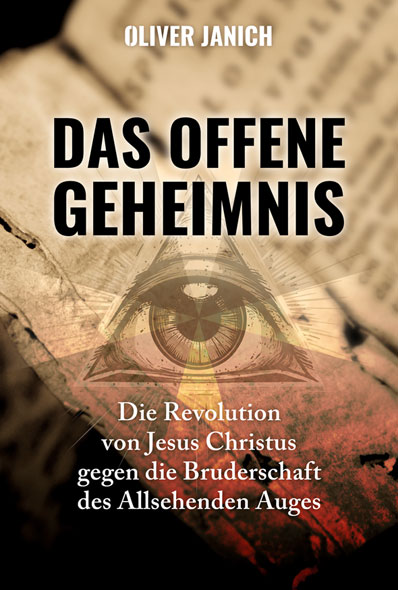
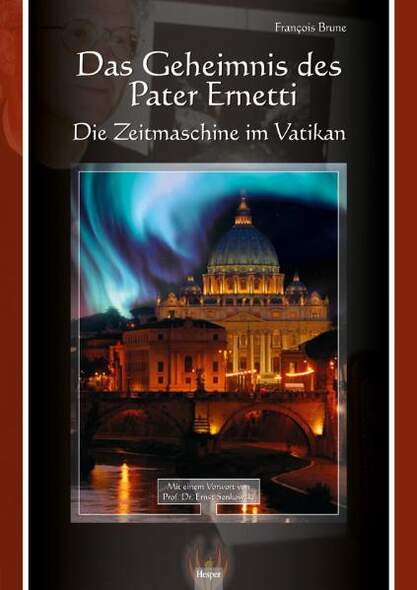
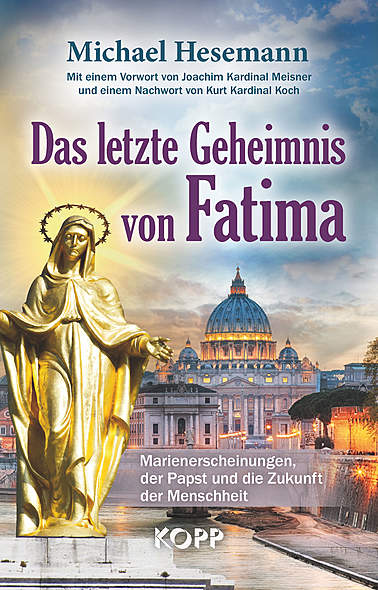

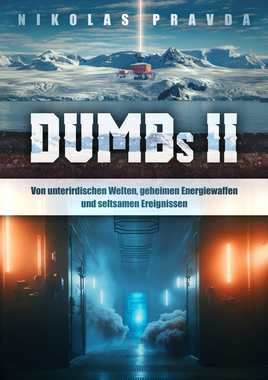
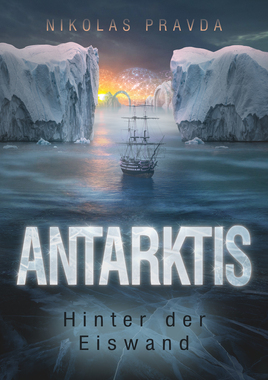
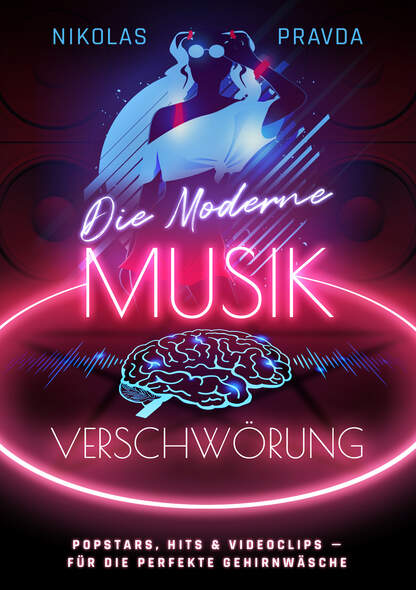
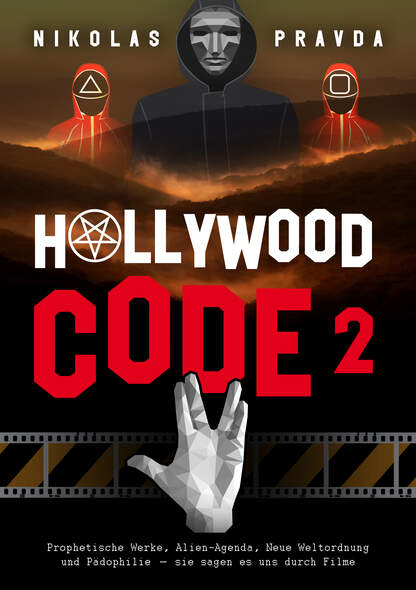

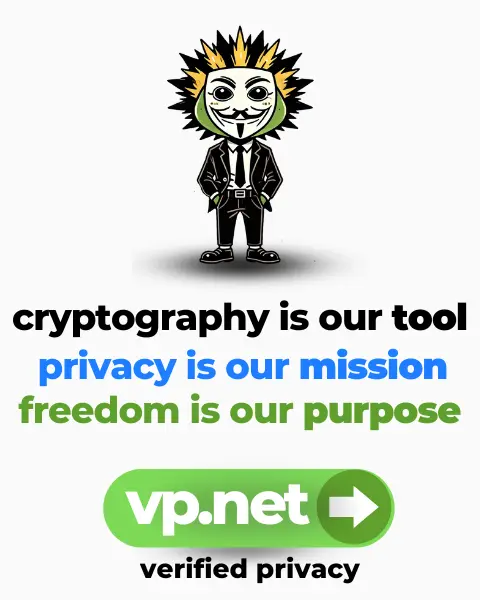
der christliche Messias soll lt Jesajaapokalypse durchbohrt sein und sterben, hierzu die Longinusmythe, die man buchstäblich auffassen kann aber nicht muß
Longinus – vom Henker zum Heiligen.
Wie geht das….
Die Kath. Kirche ist das Römische Reich, alle Päpste waren im rechtlichem Sinn auch Kaiser des römischen Reiches.
Jesus war Feind des Römischen Reiches, von daher ist Longinus als held und Heiliger zu verehren.