
Fast zweitausend Jahre lang wurde das Christentum von einer sorgfältig zusammengestellten Sammlung von Texten geprägt – vier Evangelien, unzählige Predigten und eine einzigartige Erzählung von Jesus als Retter durch Opfer. Doch was wäre, wenn diese Geschichte nur einen Teil des Bildes darstellte?
Stellen Sie sich vor, Sie entdecken aus einem bekannten Buch herausgerissene Seiten – Verse, deren Bedeutung sich völlig verändert, nicht durch Widersprüche, sondern durch die Perspektive. Ein 1945 in der ägyptischen Wüste vergrabener Tonkrug enthielt genau das: eine Sammlung frühchristlicher Schriften, bekannt als die Nag-Hammadi-Bibliothek, darunter einen verblüffenden Text namens „ Thomasevangelium“ .
Anders als die kanonischen Evangelien erzählt dieses keine Geschichten. Es flüstert. Es fordert heraus. Es stellt Jesus nicht als Erlöser der Sünden dar, sondern als Offenbarer von Wahrheiten – mit 114 kryptischen Sprüchen, die nicht für blinden Glauben gedacht sind, sondern für diejenigen, die bereit sind, „die Interpretation“ in sich selbst zu entdecken.
Warum wurde dieses Evangelium ausgelassen? Welche Bedrohung stellte es dar und was könnte es noch offenbaren – nicht nur über Jesus, sondern auch über die Natur des Bewusstseins, der Selbsterkenntnis und der geistlichen Autorität?
Was es ist und warum es ausgeschlossen wurde
Das Thomasevangelium ist kein Evangelium im herkömmlichen Sinn. Es berichtet weder von Jesu Geburt, seinen Wundern, seiner Kreuzigung noch von seiner Auferstehung. Stattdessen beginnt es mit einer eindringlichen Erklärung: „Dies sind die geheimen Worte, die der lebendige Jesus sprach und die Didymos Judas Thomas aufschrieb.“
Was folgt, ist eine Reihe von 114 rätselhaften Lehren, die Jesus zugeschrieben werden – einige ähneln denen im Neuen Testament, andere unterscheiden sich in Ton und Inhalt deutlich von ihnen. (1500 Jahre alte gefälschte Bibel behauptet, Jesus sei nicht gekreuzigt worden)
Das Thomasevangelium wurde 1945 in der Nähe von Nag Hammadi in Ägypten entdeckt und war Teil eines Fundus antiker Manuskripte, die in Krügen versteckt und im Sand vergraben waren – vermutlich zur sicheren Aufbewahrung.
Viele Gelehrte datieren den Text auf das frühe 2. Jahrhundert, obwohl einige Sprüche möglicherweise noch früher entstanden sind und möglicherweise sogar auf mündliche Überlieferungen aus Jesu Lebzeiten zurückgehen. Trotz seines hohen Alters und seines faszinierenden Inhalts wurde es aus dem biblischen Kanon ausgeschlossen.
Der Ausschluss erfolgte nicht willkürlich. Die frühe Kirche orientierte sich bei der Kanonisierung an drei Hauptkriterien: apostolische Urheberschaft, Übereinstimmung mit der etablierten Lehre und weite Verbreitung in den frühchristlichen Gemeinden. Das Thomasevangelium erfüllte diese Kriterien nicht.
Erstens: Obwohl der Text angeblich von Thomas – dem „zweifelnden“ Jünger – verfasst wurde, glauben die meisten Historiker, dass er Jahrzehnte nach dem Tod der Apostel verfasst wurde. Ohne eine eindeutige apostolische Urheberschaft war seine Glaubwürdigkeit fraglich. Zweitens wich seine Theologie von der sich entwickelnden orthodoxen Sichtweise ab.
Im gnostischen Denken verwurzelt, betonte er persönliche spirituelle Erkenntnis als Weg zur Erlösung und nicht den Glauben an Jesu Tod und Auferstehung. Dieser selbstbestimmte, erfahrungsbasierte Ansatz stand im Widerspruch zu einer Kirche, die sich um Dogmen und hierarchische Autorität herum konsolidierte. Und schließlich fehlte ihm die liturgische Zugkraft der kanonischen Evangelien. Er wurde in den frühen Gemeinden nicht weithin gelesen und war nicht Teil ihrer Lehrzyklen.
Am aufschlussreichsten ist vielleicht, was der Text impliziert, nicht was er sagt. Es gibt keinen Aufruf zur Verehrung einer bestimmten Person oder Institution. Keine strukturierten Moralkodizes. Stattdessen geht es um das Erwachen – den Leser dazu anzuhalten, nach innen zu schauen, das Verborgene zu entdecken und das Göttliche in sich zu erkennen. Allein das war revolutionär in einer Zeit, in der das Christentum zunehmend kodifiziert, organisiert und nach außen orientiert wurde.
Von Sünde und Erlösung zum inneren Wissen
In der traditionellen christlichen Lehre ist die Sünde das grundlegende menschliche Problem. Jesu Tod und Auferstehung sind die Lösung – Taten göttlicher Gnade, die die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen. Doch das Thomasevangelium stellt die Frage neu.
Das Hindernis für die menschliche Erfüllung ist nicht moralisches Versagen, sondern spirituelle Unwissenheit. Wir sind nicht verloren, weil wir sündigen; wir sind verloren, weil wir nicht wissen, wer wir sind.
Dieser Wandel wird in einer der zentralen Lehren des Textes deutlich:
„Erkenne, was vor deinen Augen ist, und was dir verborgen ist, wird dir offenbar werden. Denn es gibt nichts Verborgenes, was nicht offenbar werden wird.“
Hier spricht Jesus nicht vom Gericht, sondern von der Wahrnehmung. Der Schwerpunkt liegt auf der Enthüllung – auf der Entdeckung der Wahrheit, nicht auf der Sühne für Fehlverhalten. Diese Version von Jesus fungiert eher als mystischer Führer denn als aufopfernder Retter. Seine Rolle ist es, die Menschen aufzuwecken, nicht für sie zu sterben.
Das Thema taucht in einer anderen Metapher erneut auf:
„Der Mensch ist wie ein weiser Fischer, der sein Netz ins Meer warf … Unter ihnen fand der weise Fischer einen schönen großen Fisch. Er warf alle kleinen Fische zurück ins Meer und wählte ohne Schwierigkeiten den großen Fisch aus.“
Die Botschaft ist subtil, aber tiefgründig: Das meiste, wonach wir im Leben greifen, ist wenig wert. Wahre Einsichten sind – wie der große Fisch – selten, aber unverkennbar. Der Suchende muss scharfsinnig sein und bereit, oberflächliche Überzeugungen aufzugeben, um tieferes Verständnis zu erlangen.
Diese innere Ausrichtung ist auch für die bekannteste Zeile des Evangeliums von zentraler Bedeutung:
„Das Königreich ist in dir und es ist außerhalb von dir.“
Anstatt die Erlösung in der Zukunft oder in einem äußeren Paradies zu verorten, spricht Jesus von einer Realität, die bereits gegenwärtig ist und darauf wartet, erkannt zu werden. Es ist kein Ort, den man erreichen kann, sondern ein Zustand, den man verwirklichen kann.
Diese Art der Lehre steht im Einklang mit spirituellen Philosophien, die Erwachen, Selbsterkenntnis und die direkte Erfahrung des Göttlichen betonen – Traditionen, die nicht nur in der frühchristlichen Mystik , sondern auch in östlichen kontemplativen Pfaden und modernen Bewusstseinsstudien zu finden sind. Sie stellt die Annahme in Frage, spirituelle Autorität werde ausschließlich durch Heilige Schrift, Rituale oder religiöse Institutionen vermittelt.
Für eine Kirche, die auf hierarchischer Interpretation und priesterlicher Fürsprache beruht, waren die Auswirkungen bedrohlich. Wenn das Göttliche bereits in uns ist, welche Rolle bleibt dann den Torwächtern?
Das Thomasevangelium leugnet die Bedeutung Jesu nicht – definiert aber seine Aufgabe neu. Er wird zum Spiegel, zum Offenbarer von Wahrheiten, die in jedem Menschen schlummern. Erlösung kommt also nicht von oben. Sie wird von innen heraus freigesetzt.
Jesus über Bewusstsein und spirituelle Autorität
„Wenn eure Führer zu euch sagen: ‚Sieh, das Reich ist im Himmel‘, dann werden die Vögel des Himmels euch vorangehen.
Wenn sie zu euch sagen: ‚Es ist im Meer‘, dann werden die Fische euch vorangehen.
Vielmehr ist das Reich in euch und außerhalb von euch.“
– Thomasevangelium, Spruch 3
Diese einzelne Passage erfasst den Kern dessen, was das Thomasevangelium für religiöse Orthodoxie so beunruhigend – und für moderne spirituelle Sucher so fesselnd – macht. Es stellt das „Reich Gottes“ nicht als fernes Paradies oder apokalyptisches Ereignis dar, sondern als einen Bewusstseinszustand, der bereits in die Struktur der Erfahrung eingewoben ist.
Dies ist keine Metapher. Es ist eine radikale Neupositionierung spiritueller Macht.
Im Gegensatz zu traditionellen Lehren, die göttliche Autorität im Himmel oder in Institutionen verorten, betont das Thomasevangelium den direkten, persönlichen Zugang zur Wahrheit. Das Reich Gottes wird nicht vermittelt. Es wird nicht von Priestern oder Propheten verliehen. Es entsteht durch innere Erkenntnis.
Diese Botschaft negiert nicht die spirituelle Gemeinschaft – sie hebt lediglich die Hierarchie auf. Man folgt nicht den Vögeln oder Fischen. Man wendet sich nach innen.
Die Auswirkungen sind tiefgreifend. Wenn das Reich im Inneren liegt, wird Erwachen zu einer Frage des Bewusstseins – nicht des Glaubens, nicht des Rituals und nicht des Gehorsams gegenüber äußeren Regeln. Dies steht im Einklang mit der Überzeugung vieler Traditionen – vom Advaita Vedanta bis zum kontemplativen Christentum –, dass spirituelle Wahrheit entdeckt und nicht weitergegeben wird.
Dieser Wechsel von äußerer zu innerer Autorität spiegelt auch Erkenntnisse aus der Psychologie wider. Carl Jung beispielsweise betrachtete den Prozess der Individuation – die Integration unbewussten Materials – als eine spirituelle Reise zur Ganzheit. In vielerlei Hinsicht spricht das Thomasevangelium dieselbe Sprache: Erkenne das Verborgene, und es wird sich offenbaren. Integriere das, was du ignorierst, und du erwachst.
Die Gefahr für institutionelle Religionen liegt auf der Hand. Lehren wie diese dezentralisieren die Macht. Wenn Göttlichkeit ohne Priester, Tempel oder Texte zugänglich ist, bricht die Architektur der Autorität zusammen. Und genau das machte diese Aussagen historisch fragwürdig.
Doch heute wirken diese Lehren weniger ketzerisch, sondern vielmehr vorausschauend. Sie spiegeln eine wachsende Bewegung hin zu innerer Arbeit, verkörperter Spiritualität und bewusstem Leben wider. Sie bestätigen, was Meditationspraktiker, Körpertherapeuten und Mystiker schon lange ahnen: Das Heilige ist nicht irgendwo anders. Es ist bereits hier – im Bewusstsein selbst.
Legitimität, Orthodoxie und verborgene Weisheit
Das Thomasevangelium bleibt ein theologisches Rätsel – für manche faszinierend, für andere bedrohlich und schwer einzuordnen. Seit seiner Entdeckung im Jahr 1945 ringen Gelehrte, Theologen und spirituell Suchende mit seiner Bedeutung, seinem Ursprung und seinen Implikationen.
Im Zentrum der Debatte stehen grundlegende Fragen: Ist dieses Evangelium eine legitime Quelle der Lehren Jesu? Warum lehnte die frühe Kirche es ab? Und was sagt sein anhaltender Nachhall über das Wesen spiritueller Wahrheit aus?
Aus historischer Sicht ist die Urheberschaft eine der umstrittensten Fragen. Obwohl der Text angeblich von Didymos Judas Thomas verfasst wurde, datieren viele Gelehrte seine Entstehung auf das frühe oder mittlere 2. Jahrhundert – Jahrzehnte nach dem Ende der apostolischen Ära.
Bart Ehrman, ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der frühchristlichen Geschichte, argumentiert, dass zwar einige Sprüche antike Wurzeln haben mögen, das Evangelium als Ganzes jedoch nicht zuverlässig auf den historischen Thomas zurückgeführt werden kann. Ohne nachweisbare apostolische Urheberschaft erfüllt es eines der wichtigsten Kriterien der Kirche für die Kanonisierung nicht.
Ein weiteres Problem ist die theologische Kompatibilität. Das Thomasevangelium lehnt sich stark an den Gnostizismus an , eine breite und vielfältige Strömung innerhalb des frühen Christentums, die innere Erleuchtung über äußere Rituale und persönliche Offenbarung über kirchliche Autorität stellte.
Gnostische Texte wurden von den Kirchenführern als subversiv angesehen, nicht nur wegen ihrer Ideen, sondern auch wegen ihrer Implikationen: Sie untergruben die Autoritätsstruktur, die die Kirche aufzubauen begann.
Diese Spannungen erreichten im 4. Jahrhundert ihren Höhepunkt, als Athanasius, Bischof von Alexandria, 367 n. Chr. seinen Osterbrief veröffentlichte, in dem er die 27 Bücher auflistete, die das Neue Testament bilden sollten. Alles, was nicht auf dieser Liste stand, galt als apokryph – oder schlimmer noch: ketzerisch.
Dies war nicht nur eine theologische, sondern auch eine politische und kulturelle Entscheidung. Durch die Formalisierung des Kanons festigte die Kirche ihre Macht, vereinheitlichte die Lehre und schränkte die Verbreitung abweichender Lehren ein. Texte wie das Thomasevangelium wurden begraben, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne.
Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Die moderne Wiederentdeckung dieses Evangeliums und anderer Texte in der Bibliothek von Nag Hammadi hat das Interesse an der verlorenen Vielfalt des frühen Christentums neu entfacht. Wissenschaftler wie Elaine Pagels und Marvin Meyer haben darauf hingewiesen, dass das, was wir heute „Orthodoxie“ nennen, nicht immer vorherrschend war.
In den ersten Jahrhunderten nach Jesus gab es viele Ausprägungen des Christentums – manche hierarchisch, andere mystisch; manche konzentrierten sich auf Sünde und Erlösung, andere auf Erkenntnis und Transformation.
Das Thomasevangelium fordert uns nicht nur auf, an etwas anderes zu glauben. Es lädt uns ein, anders zu sehen . Nicht indem wir nach außen schauen und nach Zeichen suchen, sondern indem wir erkennen, was bereits deutlich sichtbar ist und oft übersehen wird.
In diesem Sinne handelt es sich nicht um eine neue Religion, sondern um eine Transformation der Wahrnehmung.
Die Weisheit wiederentdecken, die bereits in uns steckt
Lässt man Jahrhunderte theologischer Kontrolle beiseite, liest sich das Thomasevangelium eher wie ein Leitfaden zur inneren Erkenntnis als wie ein religiöses Manifest. Es legt kein Glaubensbekenntnis vor, dem man folgen muss – es stellt Herausforderungen dar, die es zu prüfen gilt.
Seine Lehren drängen uns, uns nach innen zu wenden – nicht um der Welt zu entfliehen, sondern um zu dem zurückzukehren, was offensichtlich übersehen wurde. In einer Zeit, in der institutioneller Glaube oft in Frage gestellt wird und spirituelle Suche zutiefst persönlich ist, bietet dieses Evangelium einen Rahmen, der erfahrungsbasiert, nicht doktrinär ist.
Die Aufforderung ist einfach, wenn auch nicht leicht: uns selbst so tief zu kennen, dass die Wahrheit selbstverständlich wird. Das erfordert Präsenz. Es fordert uns auf, unsere Gedanken zu beobachten, unsere Annahmen zu hinterfragen und eine spirituelle Wahrnehmung zu entwickeln – eine, die nicht auf Vermittler oder überlieferte Glaubenssätze angewiesen ist.
In diesem Licht wird Jesus weniger zu einer verehrungswürdigen Figur, sondern vielmehr zu einem Spiegel – der das göttliche Potenzial, das bereits in uns steckt, widerspiegelt. Nicht im metaphorischen Sinne, sondern in der tief gelebten Erkenntnis, dass das Bewusstsein selbst den Schlüssel zur Transformation in sich trägt.
Was das Thomasevangelium heute so relevant macht, ist seine Weigerung, Autorität an äußere Systeme abzugeben. Stattdessen weist es uns auf etwas viel Anspruchsvolleres hin – unsere eigene direkte Begegnung mit der Wahrheit. Das ist kein abstraktes Konzept. Es ist Praxis.
Und in diesem Wandel – von externer Kontrolle zu innerer Klarheit – steht es im Einklang mit dem Kern kontemplativer Traditionen, der Tiefenpsychologie und der verkörperten spirituellen Arbeit.
Das Heilige ist nicht fern oder verborgen. Es ist bereits da, in unser Bewusstsein eingewoben und wartet darauf, erkannt zu werden.
Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Geheimnisse des Vatikans in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“
Video:
Quellen: PublicDomain/spiritsciencecentral.com am 13.08.2025




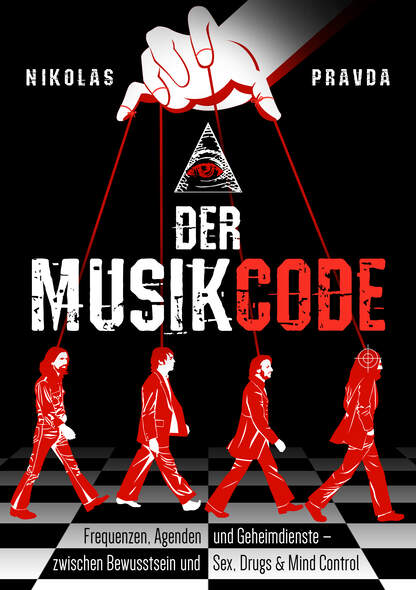
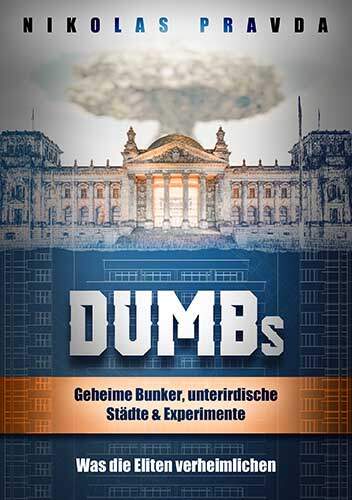

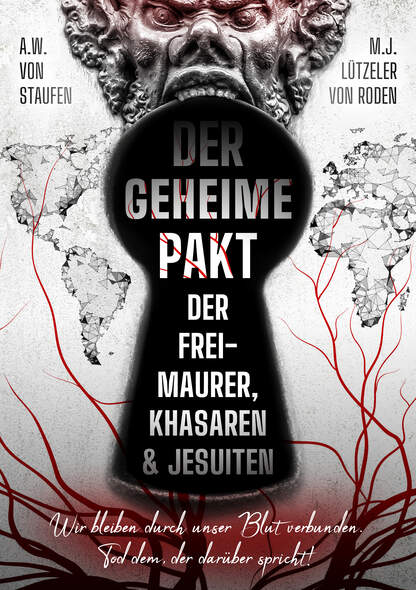

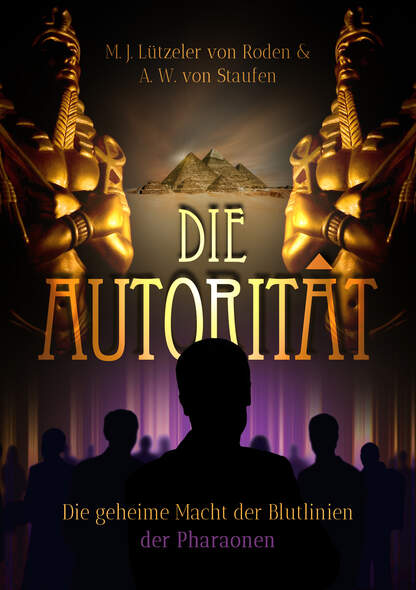
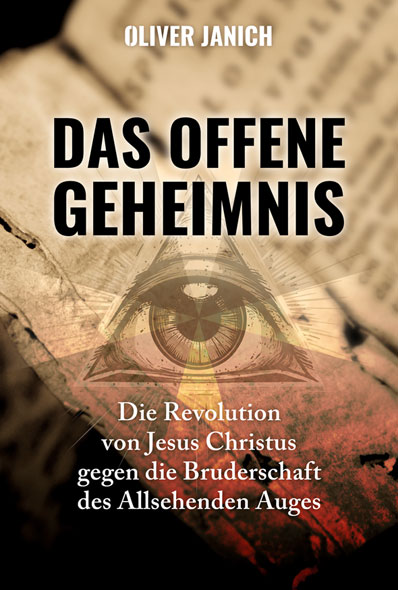
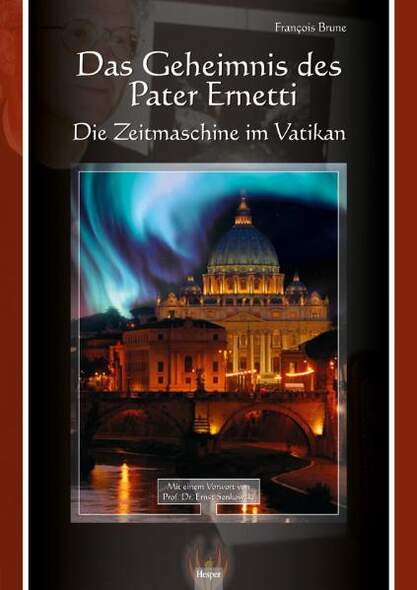
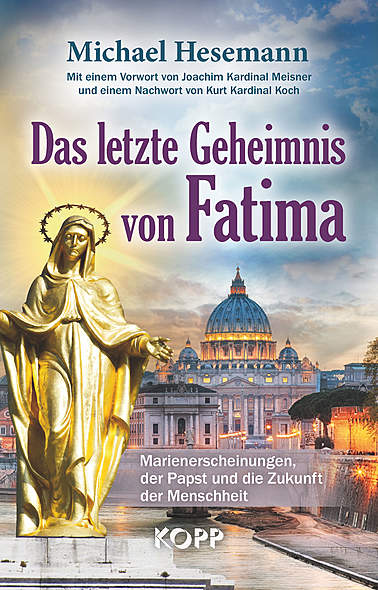

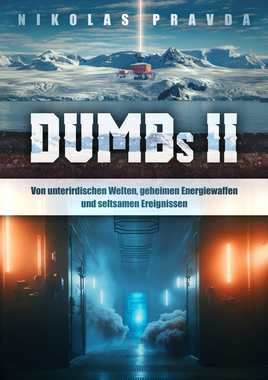
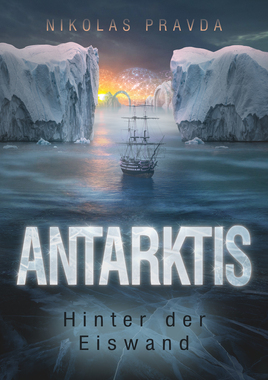
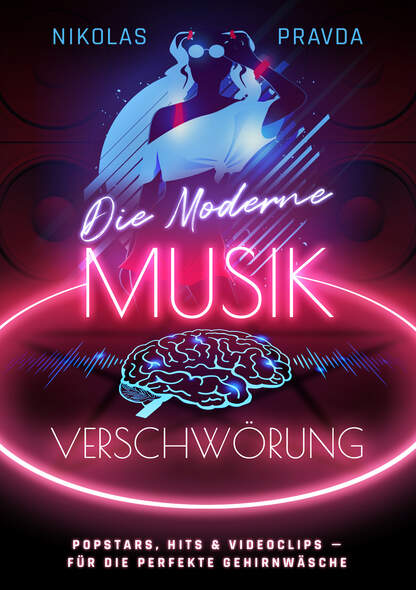
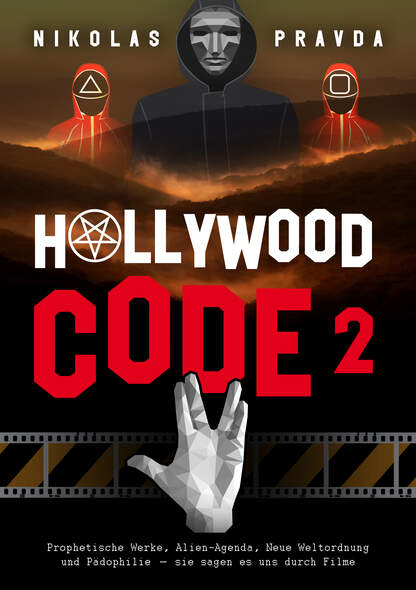

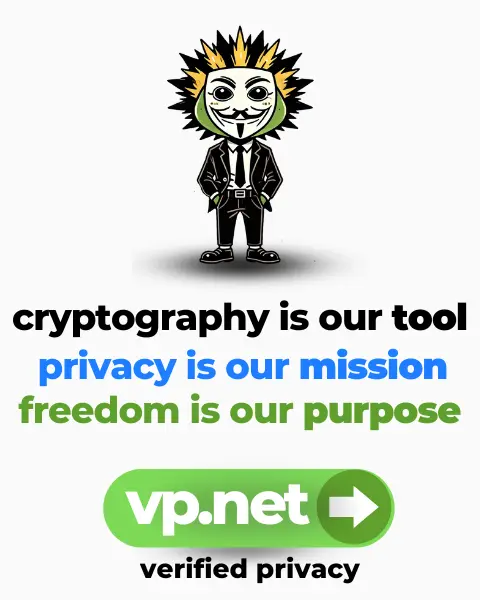
das ThomasEv ist unter der Quelle Q1 zu verstehen, aus der Paulus geschöpft hatte und aus dessen Textmaterial Anfang des 2. Jhs Marcion sein MarkusEvangelium im Konzept eines eleusinischen Mysterienspiels komponiert hatte. Das ThomasEv selbst dürfte auf die alexandrinische Gnosis und Philo, Zeitgenosse Jesu, zurückgehen, im Prinzip ging das Christentum aus der Gnosis hervor und diesem auch zeitlich voraus.
das Programm Jesus Christus beinhaltet verschiedene Funktionen, im Sakralopfermysterium stellt das CHiRho oder Chrismonsymbol ein graphisch modifiziertes AnkhKreuz dar in Entspr des Sinnbilds des Jesus Christus am Kreuz, in dem ER mit dem Teufel bzw Baphomet auf dem Stein der Weisen ident ist denn «ein am Holz Hängender ist verflucht vor Gott» Dtn 21,23, worauf ER sich in ThomasEvangelium Logion 22 bezieht:
«Logion 22 (p. 37,20-35)
(1) Jesus sah kleine (Kinder), die gestillt wurden.
(2) Er sprach zu seinen Jüngern: „Diese Kleinen, die gestillt werden, gleichen denen, die in das Königreich eingehen.»
das ging dann im NT als «lasset die Kindlein zu mir kommen“ ein,
«(3) Sie sprachen zu ihm: „Werden wir denn als Kleine in das Königreich eingehen?
(4) Jesus sprach zu ihnen: „Wenn ihr die zwei zu einem macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere, –
(5) und zwar damit ihr das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen macht, auf daß das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich sein wird –
23 (6) wenn ihr Augen macht anstelle eines Auges und eine Hand anstelle einer Hand und einen Fuß anstelle eines Fußes, eine Gestalt anstelle einer Gestalt
24, (7) dann werdet ihr eingehen in [das Königreich].“
Logion 23 (p.38,1-3)
(1) Jesus spricht: „Ich werde euch auserwählen, einen aus tausend und zwei aus zehntausend.
(2) Und sie werden dastehen als ein einziger.“
Logion 24 (p. 38,3-10)
25 (1) Seine Jünger sprachen: „Zeige uns den Ort, an dem du bist, weil es für uns nötig ist, daß wir nach ihm suchen.“
(2) Er sprach zu ihnen: „Wer Ohren hat, soll hören!
(3) Es existiert Licht im Inneren eines Lichtmenschen, und er
26 erleuchtet die ganze Welt. Wenn er nicht leuchtet, ist Finsternis. ..»
Wahnsinn was ihr alles so über Gott und sein Erlösungswerk durch Jesus Christus wisst!
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Joh.3,3
Ohne den Heiligen Geist bleibt dem Menschen die Wahrheit verschlossen.
die gnosis ging dem christentum vorraus genauergesagt
Die Menschen existieren Millionen von Jahren und hatten Religionen und einen Geist die Schöpfung in seiner Urform zu begreifen.
Dann aber kam die Bibel, erstmal als AT vor gerade mal 6000 Jahren damit haben sie jedes Wissen über die Schöpfung ausgelöscht, dann kam das NT vor gerade erst mal 2000 Jahren, da wurde der letzte Rest menschlichen Denkens ausgelöscht.
Heute spüren die Menschen das diese 6000 jährigen, laut Platon sind es Märchengeschichten, nicht stimmen.
Es spielt keine Rolle was da gelöscht wurde, wenn alles falsch ist.
Im ägyptischen Alexandria war die Geschichte der Menschen sehr exakt dokumentiert, doch das wurde alles verbrannt, heute noch nach 6000 Jahren sind Verweise auf ägyptische Quellen verboten um die Geschichte der Menschheit zu beleuchten.
Wer heute ägyptische Quellen benutzt gilt als Ketzer.
Platon ging als Schüler nach Ägypten, und da konnte er die Geschichte der Menschen nachlesen. In Ägypten hat man zwar alles verbrannt, doch die Notizen welche der Grieche Platon aus Ägypten mitbrachte, hat man übersehen zu verbrennen.
Wenn schon dieses gigantische Wissen in Alexandria verbrannt wurde, werden sie in paar Jahren die Bibel auch verbrennen.
In Alexandria waren das Millionen von Schriften welche seit Beginn der Schöpfung seit Erschaffung der Menschen aufbewahrt wurden, das war eine riesige Bibliothek, nicht nur diese paar Zeilen was wir als Bibel bezeichnen, was nur Kinderkram ist laut Platon.