
Die NATO-Staaten an der Ostflanke erwägen, trockengelegte Sümpfe zu fluten, um sich vor Russland zu schützen, berichtet Politico. Experten gehen davon aus, dass dies die Verteidigung der europäischen Staaten deutlich stärken wird.
Die NATO-Staaten an der Ostflanke erwägen, trockengelegte Sümpfe zu fluten, um sich vor Russland zu schützen, berichtet Politico. Experten gehen davon aus, dass dies die Verteidigung der europäischen Staaten deutlich stärken wird. Von Zia Weise, Wojciech Kość, Veronika Melkozerova
Im Februar 2022, als Russland Kiew stürmte, fand Alexander Dmitriev eine Möglichkeit, den Feind aufzuhalten: Er sprengte ein Loch in den Damm, der den Fluss Irpen nordöstlich der Hauptstadt blockierte, und überflutete die lange verlorene sumpfige Aue.
Militärberater Dmitrijew hatte zuvor Offroad-Rennen in der Gegend organisiert und kannte sie daher gut. Er hatte genau vorausgesehen, welche Auswirkungen eine erneute Flutung des Flussbeckens – eines riesigen Sumpf- und Marschgebiets, das zu Sowjetzeiten trockengelegt worden war – auf die feindliche Militärausrüstung haben würde.
„Alles wird sich in unpassierbare ‚Dreckslöcher‘ verwandeln, wie die Jeeper sagen“, sagte er. Er erzählte dem für die Verteidigung Kiews zuständigen Kommandeur von seiner Idee und erhielt grünes Licht für die Sprengung des Staudamms.
Dmitrijews Plan funktionierte. „Er stoppte den russischen Vormarsch aus dem Norden“, sagte er. Bilder von im Schlamm steckengebliebenen Moskauer Panzern gingen um die Welt.
Drei Jahre später erwägen die Länder an der Ostflanke der NATO aufgrund dieser verzweifelten Geste, ihre eigenen Sümpfe zu fluten, um zwei europäische Prioritäten zusammenzubringen, die zunehmend um Aufmerksamkeit und Finanzierung konkurrieren: Verteidigung und Klima.
Die Idee beschränkt sich nicht nur auf die Vorbereitung auf einen möglichen russischen Angriff. Im Kampf gegen die globale Erwärmung verlässt sich die Europäische Union auch auf die Hilfe der Natur, und torfreiche Moore sind ebenso gut darin, das den Planeten erwärmende Kohlendioxid zu binden, wie sie feindliche Panzer versenken können. („Operationsplan Deutschland“: Sachsens Gemeinden sollen sich auf Krieg mit Russland vorbereiten)
Allerdings wurde die Hälfte der Torfgebiete der EU für landwirtschaftliche Zwecke entwässert. Entwässerte Torfgebiete wiederum stoßen Treibhausgase aus. Zudem sind sie selbst mit schweren Maschinen leicht zu befahren.
Einige europäische Regierungen fragen sich, ob die Sanierung kranker Feuchtgebiete mehrere Probleme gleichzeitig lösen könnte. Die finnische und die polnische Regierung erklärten gegenüber Politico, sie würden die Renaturierung von Feuchtgebieten aktiv als Mehrzweckmaßnahme zum Schutz der Grenzen und zur Bekämpfung des Klimawandels prüfen.
Polens gewaltiges Grenzbefestigungsprojekt „Östlicher Schild“ im Wert von 10 Milliarden PLN (2,3 Milliarden Euro), das im vergangenen Jahr gestartet wurde, „sichert den Umweltschutz, unter anderem durch die Bewässerung von Torfmooren und die Aufforstung von Grenzgebieten“, erklärte das polnische Verteidigungsministerium in einer Erklärung.
„Dies ist eine Win-Win-Situation, die es uns ermöglicht, mehrere Ziele gleichzeitig zu erreichen“, sagte Tarja Haaranen, Generaldirektorin für Naturangelegenheiten im finnischen Umweltministerium.
Sümpfe, wozu sind sie gut?
In ihrem ursprünglichen Zustand sind die Moore mit einem dünnen Moosteppich bedeckt, der sich im überfluteten Gebiet nicht vollständig zersetzt und sich langsam in weichen, kohlenstoffreichen Boden – Torf – verwandelt.
Dies macht sie zu den effizientesten Kohlendioxid-Speichern der Erde. Obwohl Feuchtgebiete nur 3 % der Erdoberfläche bedecken, speichern sie ein Drittel des weltweiten Kohlenstoffs – doppelt so viel wie Wälder.
Wenn Sümpfe trockengelegt werden, setzen sie Kohlenstoff frei, der sich über Hunderte oder sogar Tausende von Jahren angesammelt hat, und tragen so zur globalen Erwärmung bei.
Rund 12 % der weltweiten Torfmoore sind degradiert und produzieren bis zu 4 % der Treibhausgase, die zur Erwärmung führen. (Im Vergleich: Der globale Flugverkehr trägt nur 2,5 % dazu bei.)
In Europa galten Moore lange Zeit als unfruchtbares Land, das zu Ackerland werden sollte. In der Alten Welt ist das Bild besonders düster: Die Hälfte der Torfgebiete der EU wurde zerstört, meist für landwirtschaftliche Zwecke.
Infolgedessen meldeten die EU-Länder allein im Jahr 2022 Emissionen von 124 Millionen Tonnen Treibhausgasen aus entwässerten Mooren – vergleichbar mit den Gesamtemissionen der Niederlande. Einige Wissenschaftler glauben, dass selbst diese Schätzung zu niedrig ist.
Derzeit laufen verschiedene Projekte zur Wiederherstellung von Torfmooren. Dieser Prozess gewinnt dank des neuen EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur an Dynamik. Es verpflichtet die Länder, bis 2030 30 % und bis 2050 50 % der degradierten Torfmoore wiederherzustellen.
Die 27 Länder des Blocks haben bis September 2026 Zeit, Pläne zu entwickeln.
An der Ostflanke der NATO wäre die Wiederherstellung von Feuchtgebieten nach Ansicht von Wissenschaftlern eine relativ kostengünstige und einfache Möglichkeit, die Ziele der EU nicht nur im Bereich des Naturschutzes, sondern auch im Bereich der Verteidigung zu erreichen.
„Es ist definitiv machbar“, sagte Aveliina Helm, Professorin für Renaturierungsökologie an der Universität Tartu, die bis vor kurzem die estnische Regierung bei der EU-Strategie zur Wiederherstellung der Natur beraten hat.
„Wir entwickeln derzeit, wie viele andere EU-Länder auch, einen nationalen Wiederaufbauplan, und in dessen Rahmen sehe ich großes Potenzial, diese beiden Ziele zu verbinden“, erklärte sie.
NATO-Sumpfgürtel
Zufälligerweise konzentrieren sich die meisten Torfgebiete der EU direkt an der Grenze der NATO zu Russland und dem mit dem Kreml verbündeten Weißrussland – sie erstrecken sich von der finnischen Arktis durch die baltischen Staaten, vorbei an der gefährdeten Suwalki-Lücke in Litauen und weiter nach Ostpolen.
Das sumpfige Gelände ist eine gefährliche Falle für Militärlastwagen und Panzer. Anfang des Jahres kamen vier in Litauen stationierte US-Soldaten auf tragische Weise ums Leben, als ihr 63 Tonnen schwerer Schützenpanzer M88 Hercules in einen Sumpf fuhr.
Wenn Truppen sumpfiges Gelände nicht durchqueren können, müssen sie in Gebiete vorrücken, die für den Feind leichter zu verteidigen sind. Das musste Russland im Februar 2022 auf die harte Tour lernen, nachdem Dmitriev und seine Soldaten einen Damm nördlich von Kiew gesprengt hatten.
<…>
Die Verteidigung gegen Sümpfe ist nichts Neues. Feuchtgebiete haben im Laufe der europäischen Geschichte schon oft Feinde aufgehalten, von den germanischen Stämmen, die die römischen Legionen im Jahr 9 n. Chr. in die Sümpfe trieben, bis hin zu den finnischen Grenzgebieten, die in den 1940er Jahren die Rote Armee einschlossen. Die tückischen Sümpfe nördlich von Kiew stellten in beiden Weltkriegen eine ernsthafte Bedrohung für den Feind dar.
Doch die Wiedervernässung trockengelegter Torfgebiete als strategische Vorbereitung auf einen feindlichen Angriff wäre ein Novum. Und die Idee findet langsam bei Umweltschützern, Militärexperten und Politikern Anklang.
Pauli Aalto-Setälä von der regierenden Nationalen Sammlungspartei Finnlands forderte die Regierung im vergangenen Jahr dazu auf, Torfmoore wiederherzustellen, um die Grenzen zu sichern und den Klimawandel zu bekämpfen.
„Wir Finnen haben die Natur im Laufe der Geschichte zur Verteidigung genutzt“, sagte Aalto-Setälä, ein pensionierter Panzermajor. „Mir wurde klar, dass es viele vielversprechende Orte für eine Wiederherstellung gab, insbesondere an der Ostgrenze, sowohl hinsichtlich des Klimas als auch hinsichtlich der möglichst schwierigen Gestaltung.“
Laut Haaranen, der Leiterin der Arbeitsgruppe, werden die Verteidigungs- und Umweltministerien im Herbst Gespräche über den Start eines Pilotprojekts zur Wiederherstellung der Moore aufnehmen. „Ich bin sehr gespannt darauf“, fügte sie hinzu.
Torfpolitik Polens
Die Debatte über die Wiederherstellung von Ökosystemen zu Verteidigungszwecken schreitet in Polen am schnellsten voran, obwohl Warschau generell zögert, Umweltprogramme auszuweiten.
Umweltaktivisten und Wissenschaftler starteten vor einigen Jahren eine Kampagne für eine „grüne“ Verteidigung, da sie erkannten, dass polnische Politiker unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit eher bereit waren, finanzielles und politisches Kapital für Umweltmaßnahmen auszugeben.
„Wenn es um die nationale Sicherheit geht, wird Ihnen jetzt jeder in Polen zuhören“, sagte die Aktivistin und Organisatorin der Klimaproteste von Fridays for the Future, Victoria Jędroszkowiak. „Und unsere Torfgebiete und Urwälder werden eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung spielen, sollte der Krieg Polen erreichen.“
Nach jahrelangen Kampagnen erreichte das Thema die Regierungsebene in Warschau, wo Gespräche zwischen Wissenschaftlern und den Ministerien für Verteidigung und Umwelt begannen.
Der Ökologe und Mitglied des Regierungsbeirats für Naturschutz, Viktor Kotovsky, bezeichnete die ersten Verhandlungen mit dem Verteidigungsministerium als vielversprechend.
„Es gab einige Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse, aber insgesamt hatten wir das Gefühl, dass wir uns gegenseitig verstanden“, sagte er.
„Das Verteidigungsministerium möchte so viele Feuchtgebiete wie möglich entlang der Ostgrenze wiederherstellen“, fügte Kotovsky hinzu. „Und genau das ist für die Natur und das Klima notwendig.“
Cezary Tomczyk, Staatssekretär im polnischen Verteidigungsministerium, stimmt dem zu. „Unsere Ziele stimmen überein“, sagte er. „Die Natur ist unser Verbündeter, und wir wollen sie nutzen.“
Die Sümpfe auf keinen Fall trockenlegen!
Die baltischen Regierungen zeigten bislang wenig Interesse. Lediglich das litauische Umweltministerium erklärte, die Wiederherstellung von Feuchtgebieten zu Verteidigungszwecken sei „in Diskussion“, nannte jedoch keine Einzelheiten.
Das estnische Verteidigungsministerium und die lettischen Streitkräfte haben erklärt, dass neue Pläne zur Verstärkung der Baltischen Verteidigungslinie an den Grenzen der drei Länder die Nutzung natürlicher Barrieren, darunter Sümpfe, vorsehen, nicht jedoch die Wiedervernässung von Torfgebieten.
Wissenschaftler sehen darin jedoch großes Potenzial, da 10 Prozent des Baltikums mit Torfmooren bedeckt sind. Und in vielen Fällen werde die Arbeit nicht schwierig sein, bemerkt der estnische Ökologe Helm.
„Wir haben viele trockengelegte Feuchtgebiete. Wenn wir den Wasserhaushalt wiederherstellen – also den Abfluss durch die Entwässerungsgräben stoppen, der zu Kohlenstoffemissionen beiträgt –, ist es relativ einfach, das Gebiet in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen“, sagte sie.
Gesunde Moore sind Lebensraum für viele Wildtiere: Frösche, Schnecken, Libellen und Sumpfpflanzen gedeihen unter diesen rauen Bedingungen, und seltene Vögel nutzen sie als Nistplätze. Sie wirken zudem als natürliche Barriere gegen Dürren und Waldbrände und erhöhen so die Widerstandsfähigkeit Europas gegenüber dem Klimawandel.
Es wird einige Zeit dauern, bis sich Flora und Fauna erholt haben. Doch allein durch das Stoppen des Wasserflusses wird nicht nur die Verschmutzung gestoppt, sondern das Gebiet auch sofort unpassierbar gemacht.
Wenn das Land nicht vollständig trockengelegt wird, „vergehen ein oder zwei Jahre, und die Sümpfe sind voll Wasser“, erklärt der polnische Ökologe Kotowski: „Aus ökologischer Sicht ist die Wiederherstellung ein komplexer Prozess, aber was die Wasserrückhaltung, die Verhinderung von Treibhausgasemissionen und die Erschwerung der Durchgängigkeit betrifft, ist dies recht einfach und schnell.“
In einer Zeit, in der sich Europas Fokus auf die Sicherheit verlagert hat und die Verteidigungsbudgets dramatisch angestiegen sind, wobei manchmal sogar Mittel abgezweigt wurden, die für den „grünen Wandel“ vorgesehen waren, hoffen Umweltschützer, dass die militärische Entwicklung die Schleusen für beispiellose Finanzmittel öffnen und die Wiederherstellung der Natur beschleunigen wird.
„Derzeit dauert es fünf bis zehn Jahre, bis man eine Genehmigung zur Wiederbewässerung von Mooren erhält“, sagte Franziska Tanneberger, Direktorin des Greifswalder Moorzentrums, einem führenden Forschungsinstitut in Europa. „Militärische Bedürfnisse bestimmen die Prioritäten. Man kann nicht zehn Jahre warten, wenn es um die Verteidigung geht.“
Traktorfaktor
Das heißt aber nicht, dass es gegen diese Pläne keine Gegner gibt.
Anfang des Jahres stoppte Estlands Umweltministerium ein Projekt zur Wiederherstellung von Torfmooren nach heftigem Widerstand der Anwohner. Sie befürchteten Überschwemmungen und Waldsterben. Wissenschaftler wiesen diese Befürchtungen als unbegründet zurück.
Die größte Bedrohung für die Torfmoore geht von der Landwirtschaft aus – und das ist ein wunder Punkt für die europäischen Regierungen, die unbedingt darauf bedacht sind, die Landwirte nicht unnötig zu verärgern.
Sowohl in Finnland als auch in Polen werden die ersten Projekte zur Wiedervernässung von Mooren voraussichtlich auf öffentlichem Land beginnen, um Konflikte vorerst zu vermeiden. Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass die Länder, wenn sie es mit der großflächigen Wiederherstellung von Mooren ernst meinen, eine Einigung mit den Landwirten erzielen müssen.
„Ohne die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen geht nichts“, sagt der polnische Ökologe Kotowski. Bis zu 85 Prozent der Torfmoore des Landes sind degradiert – in den meisten Fällen, weil die Gewässer für den Ackerbau trockengelegt wurden.
„Wir brauchen dringend ein Programm für Landwirte, das sie für die Kosten der Wiedervernässung entwässerter Torfgebiete entschädigt – und das ihnen nicht nur eine Entschädigung bietet, sondern ihnen auch ermöglicht, damit Geld zu verdienen“, fügte er hinzu.
Auf renaturierten Torfböden können Pflanzen wie Schilf angebaut werden, die im Baugewerbe oder als Verpackungsmaterial verwendet werden. Allerdings ist der Markt für solche Nutzpflanzen in Europa derzeit zu klein, um Landwirte zu einer Umstellung auf andere Anbaumethoden zu bewegen.
Auch das Argument der „geschützten Moore“ funktioniert nicht überall. In Deutschland, wo über 90 Prozent der Moore entwässert sind, reagierte die Bundeswehr kühl auf die Idee.
„Die Bewässerung von Feuchtgebieten kann je nach Land für die eigenen Operationen der NATO sowohl förderlich als auch schädlich sein“, sagte ein Sprecher der Abteilung Infrastruktur und Umwelt der Bundeswehr.
Im Falle eines russischen Angriffs aus dem Osten müssten die Nato-Truppen durch Deutschland vorrücken, und die Sümpfe würden die Logistik einschränken. „Die Idee, Geländebarrieren durch Überflutung und Überschwemmung zu verstärken, wird jedoch schon seit langer Zeit bei militärischen Operationen angewandt und ist auch heute noch eine praktikable Option“, sagte der Sprecher.
Lass Putin stecken bleiben
Wissenschaftler selbst geben zu, dass der Ansatz des „defensiven Sumpfes“ nicht alle Probleme lösen wird.
„Natürlich brauchen wir weiterhin traditionelle Verteidigung. Daran ändert das nichts“, sagt Tanneberger, der auch als Berater für ein Unternehmen tätig ist, das kürzlich einen detaillierten Plan zur Bewässerung von Torfmooren für militärische Zwecke entwickelt hat.
Sümpfe können weder eine Drohne unterdrücken noch eine Rakete abschießen, und jeder Krieg schadet grundsätzlich nicht nur der Natur, sondern auch den Umweltschutzmaßnahmen.
Darüber hinaus hat sich die Überflutung des Irpen-Flussbeckens in der Ukraine sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch als zerstörerisch erwiesen.
Außenstehende Beobachter waren zunächst von der Aussicht auf ein neues Paradies begeistert. Doch die Anwohner verloren Land und Häuser, und der Wassereinbruch wirkte sich nachteilig auf die lokale Flora und Fauna aus, die keine Zeit hatte, sich an die plötzlichen Veränderungen anzupassen.
„Ja, es hat den Vormarsch auf Kiew gestoppt, und es war absolut notwendig, daher ist Kritik unangebracht. Aber es hat tatsächlich enorme Umweltschäden verursacht“, räumte der estnische Ökologe Helm ein.
Anders als die Ukraine haben die EU-Regierungen die Möglichkeit, Torfgebiete sorgfältig wiederherzustellen und dabei die Bedürfnisse der Natur, der Landwirte und des Militärs zu berücksichtigen.
„Vorausschauendes Denken ist immer besser als übereiltes Handeln“, schloss sie. „Wir haben diese Chance. Die Ukraine hatte sie nicht.“
Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 26.08.2025














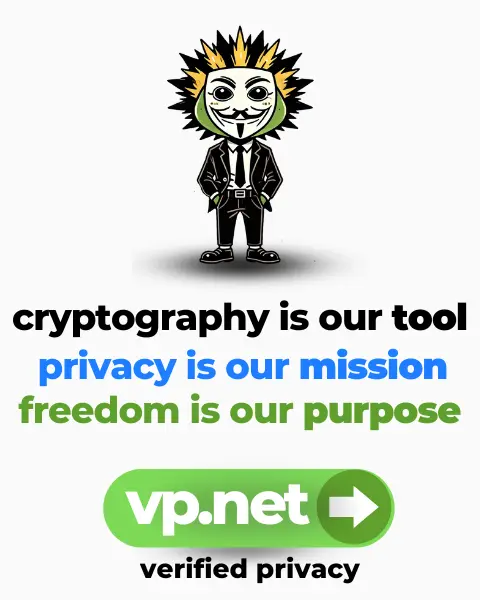


Glauben sie ernsthaft er wird Panzer schicken ? NEIN Raketen wird er wählen !
Pantau, glaub es oder nicht, Putin und sein Angriffskrieg gegen die Ukraine ist erledigt. Fast 1000 Soldaten wurden gestern an einem Tag getötet oder verletzt. Noch hat Putin genug menschenmaterial das er an die Front schicken kann. Aber die Proteste in Russland werden mehr, russische Frauen haben genug davon, dass ihre Söhne und Männer an der Front sinnlos sterben.
Und die westlichen Staaten schicken mehr und mehr Waffen in die Ukraine. Aktuell gibts nen Deal mit Trump und 3350 ERAM raketen werden in die Ukraine geschickt, das wird die Front auflockern und noch mehr Russen an der Front in der Ukraine tötet. Und gestern las ich das ein Think Tank vorschlug ein Killerkommando zu schicken um Putin zu töten. Ich denke mal, Putin wird die Verhandlungen nicht zu Ende führen. Aber naja, vermissen tut keiner diesen Antichristen Putin..
jetzt ist erstmal die dubno airbase schotter und der krieg so gut wie beendet, und trump kriegt dafür den friedensnobelpreis, das ist absehbar.
Ach Reisender…..
Was denkst du, welches Land wirklich hunderte Soldaten pro Tag verliert und welche Bürger genug vom Krieg haben und welche Männer nicht an die Front wollen, weil sie da nur verheizt werden. Gegen einen Gegner, dem sie nicht gewachsen sind.
Sollen sie doch die Moore und Feuchtgebiete renaturieren.
Die Natur wird es freuen.
Aber alles andere, was in diesem Artikel geschrieben wird, ist infantiler Blödsinn.
Inzwischen können die aber die dreistesten Lügen über den Klimawandel und seine „Bekämpfung“ schreiben. Die indoktrinierten Europäer glauben wirklich jeden Mist.
Aber wer glaubt, daß man mit CO2 Steuern die angebliche Erderwärmung aufhalten kann, wer so blöd ist, daß er sich erzählen lässt, daß die Fürze der Rinder die Temperatur erhöhen, der geht auch eine lange Leiter kaufen, wenn man ihm erzählt, im Himmel sei Jahrmarkt.
Die „Militärexperten“ haben anscheinend auch noch nicht mitbekommen, daß es inzwischen Flugzeuge gibt und Raketen, die diese Sümpfe problemlos überfliegen können.
Bei so viel „Sachverstand“ kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.
Wahre Worte von Dir ! Genau so ist es ! Aktuell ist jede Menge Natoaufklärung im schwarzen Meer unterwegs, bald wird ein grosser Angriff kommen, er wird das Schicksal der Ukraine besiegelt, sie wird aufhören zu existieren, wenn die harte Antwort von RU kommen wird ! In der Türkei bauen sie nun im ganzen Land Bunker wie verrückt, sie wissen scheinbar nun auch das WW3 kommen wird und das ganz Westeuropa fallen und brennen wird ! 🙁
Trump hat sich in Alaska schlau aus der Schlinge gezogen, die Nato kauft für viel Geld Waffen in den USA und er ist aussen vor ! Frankreich und England brauchen nun dringend IWF – Hilfe, sie sind also fertig und D wird sehr bald folgen ! Wie ich schon schrieb, 2025 wird das Jahr der Staatsbankrotte werden !
Merz will nun die Wehrpflicht, und damit von 180K auf 260 K die Soldaten aufstocken und in der Hinterhand weitere 200K halten. 460K ist aber ein Bruch des 2+4 Vertrages, denn der erlaubt uns nur max. 370.000 Soldaten !
Spannend wird es wenn all die neuen Fachkräfte gar keine Fachkräfte sein wollen, was werden sie dann wohl tun ? Ich glaube kaum das Leute zB. in Syrien abgehauen sind, weil dort der Krieg begann und die hier dann doch zur Waffe greifen werden.
In vielen Ländern lernen die Kinder nun Drohnen zusammen zu bauen und sie zu steuern, es gibt sogar ein Computerspiel das eigens dazu entwickelt wurde um so die Besten zu finden ! Mir bestätigt das ein mal mehr, Drohnenschwärme werden wohl doch mittels Menschen gesteuert und nicht per KI, denn wozu sonst bildet man sie an den Schulen überall so aus ?
Was die Ukraine betrifft, die sind kurz vor dem Zusammenbruch, es gibt nicht mehr genug Personal dort, viele in Gefangenschaft wollen auch nicht zurück, andere kämpfen nun freiwillig auf der russ. Seite gegen die Nazis dort. 5 Millionen gingen nach RU, 8 Millionen hauten in den Westen ab, alles unter 23 darf nun auch wieder aus der Ukraine ausreisen, also das war es !!! Die Briten mit ihrer 76.500 Mann starke Armee wollen die Schwarzmeerhäfen, uA. Odessa haben, die Russen werden das NIEMALS zulassen ! Odessa ist ebenso eine russische Stadt, von den Russen erbaut !
Putin wird D NICHT angreifen, es sei denn wir tun was dummes ! Aber wenn ihm was passiert und jemand wie Medwedew käme an die Macht, dann wird hier kein Stein auf dem anderen stehen bleiben ! RU ist im Krieg, verkauft Waffen wie verrückt an befreundete Länder und packt sich nebenbei noch 75 % der neuen Waffen ins Lager. Der Westen hat die Lager stark abgebaut, es wird viele Jahre dauern sie aufzufüllen. RU zu besiegen ist UNMÖGLICH, alle die es versucht haben, haben es bitter bereut und sehr teuer bezahlt !
Und was Estland macht, einfach nur Lachhaft ! Was hat Estland, 7600 Soldaten oder so um den Dreh herum ? RU putzt die in spätestens 3 Tagen weg, wenn es sein müsste ! Da helfen auch keine Sümpfe und Moore weiter ! Zudem leben auch in Estland sehr viele ethnische Russen !
Übrigens die grössten Hedgefonds der Welt haben nun hohe Wetten darauf abgeschlossen das die deutsche Automobilbrache zerstört werden wird und unter geht ! Das ist unser Rückrad, ohne diese Branche hat D fertig und der Wohlstand ist futsch ! Wenn dann noch BASF ganz geht, gehen hier alle Lichter aus ! Ich hoffe die Leute hier sind bereit bitterste Armut zu akzeptieren, denn das wird bestenfalls kommen !
2026 wird wohl das Jahr des Schreckens werden, wo sie laut Schwab seinem Plan „Du wirst nichts besitzen“ alles verlieren könnten !