
Die Frage nach der Entstehung des Lebens war noch nie einfach, und eine neue Studie des Imperial College London verleiht einem der schwierigsten Probleme der Wissenschaft Tiefe und Kontroverse zugleich.
Robert G. Endres‘ im Juli 2025 veröffentlichte Abhandlung mit dem Titel „ The Unreasonable Likelihood of Being: Origin of Life, Terraforming, and AI“ setzt sich mit den mathematischen und informationstheoretischen Herausforderungen der Abiogenese auseinander und zieht gleichzeitig ernsthaft Alternativen wie gerichtete Panspermie und Terraforming in Betracht.
Statt diese Ideen als spekulative Fiktion abzutun, stellt Endres sie als logisch machbare Szenarien dar, die gegen die erschütternde Unwahrscheinlichkeit der Selbstentstehung von Leben unter den chaotischen Bedingungen der frühen Erde abgewogen werden müssen.
Seine Analyse, die auf Informationstheorie und algorithmischer Komplexität beruht, legt nahe, dass Leben zwar auf natürliche Weise entstanden sein könnte, der Informationsbedarf jedoch so extrem ist, dass ein Eingreifen von außen nicht ausgeschlossen werden kann.
Endres formuliert das Problem, indem er auf das älteste Rätsel der Biologie zurückgreift: Alle Zellen stammen von anderen Zellen ab, doch woher stammte die erste Zelle? Entweder entstand sie allein durch Chemie und Physik oder sie wurde von irgendwo außerhalb der Erde eingepflanzt.
Die erste Option, die spontane Abiogenese, ist in der etablierten Wissenschaft nach wie vor die bevorzugte Erklärung, doch ihre Details sind mit Unsicherheiten behaftet. Die zweite, lange Zeit marginalisierte, aber nie ausgeschlossene Möglichkeit besagt, dass das Leben von einer höheren Intelligenz hervorgebracht oder ausgelöst wurde.
Hier bezieht sich Endres auf die Panspermie, die erstmals 1973 von den Nobelpreisträgern Francis Crick und Leslie Orgel vorgeschlagen wurde, sowie auf das Konzept der Terraformung.
Er weist darauf hin, dass das, was einst wie Science-Fiction klang, heute in der wissenschaftlichen Literatur zu einem echten Diskussionsthema geworden ist, da Pläne zur Manipulation von Mars und Venus diskutiert werden.
Der Kern der Arbeit ist nicht kultureller, sondern rechnerischer Natur. Endres wendet die Rate-Distortion-Theorie aus der Informationswissenschaft an, um abzuschätzen, ob die frühe Erde über genügend Informationsdurchsatz verfügte, um die Schwelle von der Chemie zur Biologie zu überschreiten. (Anunnaki enthüllt: Wer waren diese Wesen laut Theorie der antiken Astronauten?)
Er berechnet die Entropie der präbiotischen chemischen Suppe und vergleicht sie mit der Informationskomplexität einer minimalen Protozelle. Die Ergebnisse offenbaren eine immense Lücke, die sich nur schließt, wenn Moleküle lange genug bestehen, Informationen effizient akkumulieren und eine strukturierte Umgebung den Prozess eher auf Speicherung als auf zufällige Dissipation ausrichtet. Eine chaotische Suppe allein ist zu verlustreich.
Ohne Kompartimente, Zyklen oder autokatalytische Systeme würde Information zerfallen, bevor sich ein organisiertes System stabilisieren könnte.
Die von ihm abgeleiteten Zahlen sind verblüffend. Eine minimale Protozelle benötigt möglicherweise etwa eine Milliarde Informationsbits, um strukturelle und dynamische Suffizienz zu erreichen.
Im Gegensatz dazu ist die Hintergrundentropie der präbiotischen Umgebung enorm, doch selbst einen Bruchteil davon zu erfassen und zu stabilisieren, ist äußerst ineffizient. Er beschreibt die Protozelle als eine schmelzende Bibliothek mit zehn Millionen Büchern, von denen sich jedes nach 24 Stunden selbst zerstört.
Gleichzeitig müssten pro Sekunde hundert Bücher gescannt werden, um genügend Material für die Erstellung einer Anleitung zum Aufbau von Leben zu erhalten. Die Analogie unterstreicht, wie unwahrscheinlich es ist, dass blinde Chemie sinnvolle Ordnung aufbaut, bevor der Zerfall den Fortschritt zunichtemacht.
In einer optimistischen Betrachtungsweise zeigt Endres, dass die benötigten zwei Bits pro Jahr über eine halbe Milliarde Jahre hinweg gesammelt werden könnten, wenn die Prozesse ausreichend beständig und gerichtet wären. Dies beruht jedoch auf Annahmen, die möglicherweise nicht zutreffen.
Würde die Informationsakkumulation einem Zufallspfad folgen, würden sich die Zeitskalen ins kosmische Unmögliche aufblähen – Hunderte von Billionen Jahren länger als das Alter des Universums.
Nur stark verzerrte und gedächtniserhaltende Prozesse könnten erfolgreich sein. Dies wirft ein zentrales Dilemma auf: Was sorgte für diese Richtungsabhängigkeit? Wenn sie nicht den geochemischen Zyklen der Erde innewohnt, dann spricht vieles für externe Eingriffe.
Der Artikel untersucht außerdem autokatalytische Netzwerke, in denen Moleküle einander kollektiv katalysieren und so möglicherweise einen plötzlichen Phasenübergang von Unordnung zu selbsterhaltender Ordnung erzeugen. Stuart Kauffmans Arbeit wird als Präzedenzfall zitiert, doch Endres erweitert die Idee, indem er chemische Reaktionsnetzwerke auf rekurrierende neuronale Netzwerke abbildet.
Dieser Ansicht nach können sie, sobald genügend interagierende Moleküle vorhanden sind, einer universellen Berechnung nahekommen. Eine Protozelle wird nicht zu einem Beutel mit Chemikalien, sondern zu einem Computersystem mit Logik, Speicher und Anpassungsfähigkeit.
Doch selbst hier sind die Schwellenwerte anspruchsvoll. Mindestens zehntausend Komponenten könnten nötig sein, bevor Berechnungen unvermeidlich werden, was Hunderttausenden von Informationsbits entspricht. Auch hier stellt sich die Frage, ob sich solche Netzwerke realistischerweise ohne Hilfe zusammensetzen könnten oder ob sie durch eine höhere Intelligenz oder einen Prozess eingeführt wurden, der über unser derzeitiges Verständnis hinausgeht.
Terraforming kommt nicht als Fiktion, sondern als Spiegel in die Diskussion. Die Menschheit diskutiert bereits über die Terraformierung des Mars mithilfe von Mikroben, atmosphärischer Manipulation und künstlich geschaffenen Ökosystemen. Wenn wir uns das heute vorstellen können, warum hätte es dann nicht schon vor Milliarden von Jahren eine andere Intelligenz tun können?
Endres weist auf das Paradoxon hin, dass Leben so früh in der Erdgeschichte auftauchte: Es gibt Hinweise auf mikrobielle Aktivität nur wenige hundert Millionen Jahre, nachdem sich der Planet nach katastrophalen Einschlägen stabilisiert hatte. Der letzte universelle gemeinsame Vorfahre könnte laut Analysen der molekularen Uhr vor etwa 4,2 Milliarden Jahren gelebt haben, erstaunlich kurz nach der Entstehung von flüssigem Wasser.
Dieser Vorfahre war kein einfacher Replikator, sondern ein metabolisch komplexer Organismus mit ATP-Synthese und sogar immunähnlichen Systemen.
Diese frühe Komplexität legt nahe, dass die erste Zelle, was auch immer sie war, sehr schnell entstanden sein musste und wenig Raum für eine langsame Abfolge chemischer Versuche und Irrtümer ließ. Diese Schnelligkeit unterstreicht die Idee eines gelieferten, nicht zusammengebauten Starterkits.
Endres scheut sich nicht vor dieser Implikation. Er räumt zwar ein, dass Ockhams Rasiermesser die Abiogenese als einfachere Erklärung bevorzugt, betont aber, dass erklärende Einfachheit nicht immer gleichbedeutend mit Wahrheit ist. Gerichtete Panspermie verlagert das Rätsel in die Biochemie einer anderen Zivilisation, löst aber zumindest die Unwahrscheinlichkeit der Abiogenese im engen Zeitrahmen der Erde.
Würde die Erde terraformt, wäre dies kein einmaliges Ereignis, sondern Teil einer umfassenderen kosmischen Strategie. Er zitiert aktualisierte Drake-Gleichungsmodelle, die nahelegen, dass selbst wenn die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung technologischen Lebens auf einem bewohnbaren Planeten nur eins zu zehn hoch vierundzwanzig beträgt, das beobachtbare Universum groß genug ist, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit andere Zivilisationen existieren.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir allein sind, geht gegen Null. Vor diesem Hintergrund ist die Vorstellung, dass eine dieser Zivilisationen die Erde manipuliert hat, nicht abwegig, sondern statistisch schlüssig.
Die Studie bringt auch künstliche Intelligenz ins Spiel. So wie AlphaFold die Proteinforschung durch maschinelles Lernen zur Strukturvorhersage revolutioniert hat, beginnen KI-Modelle ganzer Zellen, die wahre Informationskomplexität des Lebens abzuschätzen. Endres schlägt vor, dass KI als neues Mikroskop fungieren könnte, das Attraktorlandschaften und verborgene Regelmäßigkeiten in chemischen Systemen aufdeckt, die der menschlichen Intuition entgehen.
Provokanter: Wenn das Leben selbst eine Form physikalischer Berechnung ist, könnte KI der Schlüssel zum Reverse Engineering des Weges von der Chemie zur Biologie sein. Auf diese Weise könnte KI nicht nur die Ursprünge des Lebens erklären, sondern auch aufzeigen, ob in den Informationssignaturen der Biologie selbst externe Eingriffe erkennbar sind.
Die Energetik unterstreicht die Effizienz des Lebens im Vergleich zur menschlichen Technologie. Endres berechnet, dass die zum Aufbau einer minimalen Protozelle benötigte Energie nur ein bis zwei Größenordnungen der theoretischen thermodynamischen Grenze beträgt. Moderne Laborsynthesen hingegen sind milliardenfach weniger effizient.
Dies deutet darauf hin, dass biologische Systeme mit nahezu perfekter Effizienz arbeiten, was wiederum die Frage aufwirft, wie ein so fein abgestimmtes System so früh entstehen konnte.
Die Abiogenese setzt voraus, dass natürliche Prozesse zufällig eine nahezu optimale Effizienz erreichten, während die Panspermie die Möglichkeit zulässt, dass eine frühere Intelligenz bereits durch die frühere Evolution verfeinerte Systeme hervorbrachte. Die Leser können ihre eigenen Schlüsse darüber ziehen, welche Art von Intelligenz dies implizieren könnte.
Er räumt ein, dass Unsicherheiten bestehen bleiben. Schätzungen der präbiotischen Entropie, der molekularen Lebensdauer und der Protozellkomplexität sind ungenau. Dennoch liefert die Studie ein quantitatives Gerüst, das die Debatte neu ausrichtet. Anstatt über vage Wahrscheinlichkeiten zu streiten, setzt Endres numerische Schwellenwerte für das, was erreicht werden muss. Das Urteil ist ernüchternd:
Eine chaotische präbiotische Umgebung würde nicht ausreichen, es sei denn, es gäbe starke Verzerrungen, Gedächtnismechanismen oder plötzliche Übergänge. Ohne diese sinken die Chancen, und die Alternative der gezielten Aussaat gewinnt an Boden.
Der vielleicht provokanteste Abschnitt des Artikels ist Endres‘ Bemerkung, dass die Menschheit selbst nun ernsthaft über die Terraformung anderer Welten nachdenkt. Wissenschaftliche Zeitschriften diskutieren über mikrobielle Manipulation des Mars und synthetische Ökosysteme zur Stabilisierung der Venus.
Wenn wir solche Eingriffe in Erwägung ziehen, ist es völlig logisch, dass andere, weitaus ältere und fortschrittlichere Lebewesen hier aktiv gewesen sein könnten. Der frühe Beginn des Lebens, seine Komplexität und seine Widerstandsfähigkeit entsprechen dem, was man erwarten würde, wenn die Erde tatsächlich vorbereitet worden wäre.
Die philosophischen Implikationen sind schwerwiegend. Wenn Leben das Ergebnis von Terraforming ist, dann ist die Menschheitsgeschichte kein chemischer Zufall, sondern Teil eines Plans, der über die Erde hinausreicht. Unsere evolutionäre Entwicklung wäre Teil einer Kette, die zu einer anderen Intelligenz zurückreicht.
Dies legt die Möglichkeit nahe, dass Zivilisationen nicht nur Biologie, sondern auch das Potenzial für Bewusstsein selbst säen. Obwohl der Artikel theologische Behauptungen vermeidet, lassen seine Schlussfolgerungen Raum für Interpretationen durch Leser, die in der Unwahrscheinlichkeit unserer Existenz einen höheren Plan sehen.
Endres schließt mit der Warnung, dass sich der Ursprung des Lebens letztlich einer vollständigen Erklärung entziehen könnte, so wie Gödel gezeigt hat, dass mathematische Systeme ihre eigene Konsistenz nicht beweisen können. Das Leben wird sich vielleicht nie vollständig selbst erklären.
Machbarkeitsstudien wie seine können jedoch den Rahmen des Möglichen definieren. Und innerhalb dieses Rahmens zwingt das Gleichgewicht der Unwahrscheinlichkeit zu einer Abrechnung: Abiogenese bleibt physikalisch möglich, doch Panspermie und Terraforming sind ernstzunehmende Konkurrenten, die ebenso viel Gewicht verdienen.
Mit mehr als zweitausend Wörtern voller Analysen und Berechnungen ist Endres‘ Studie keine sensationelle Behauptung, sondern eine rigorose Auseinandersetzung mit den Zahlen. Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie die gerichtete Panspermie und das Terraforming von der kulturellen Spekulation in den Bereich der quantitativen Wissenschaft verlagert.
Quellen: PublicDomain/abovethenormnews.com am 09.09.2025



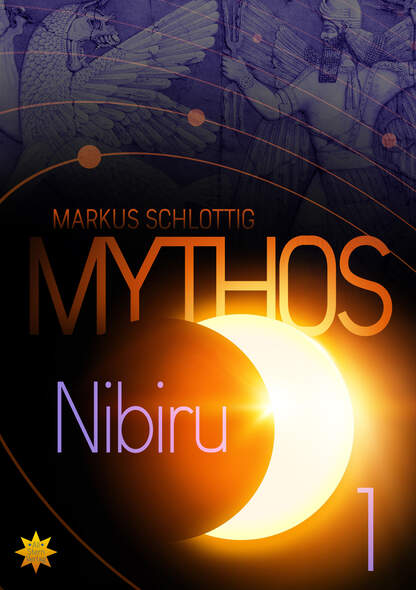
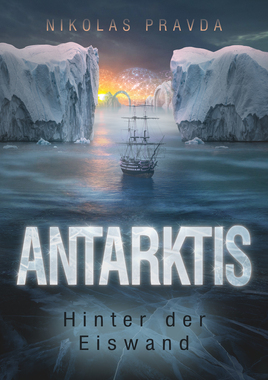
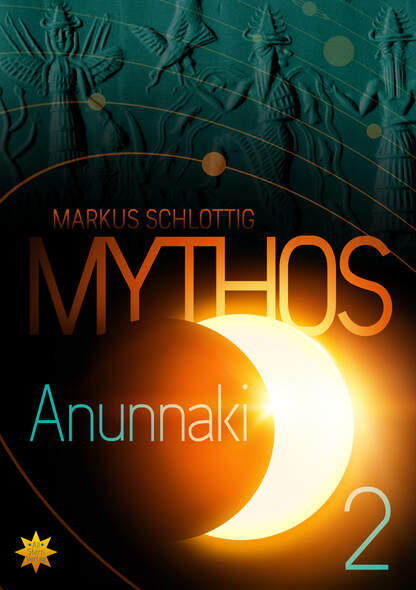

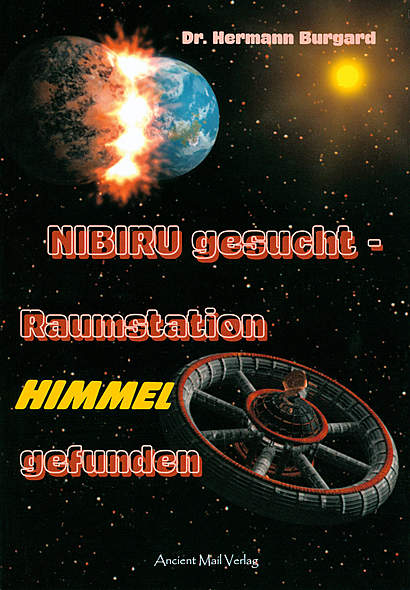
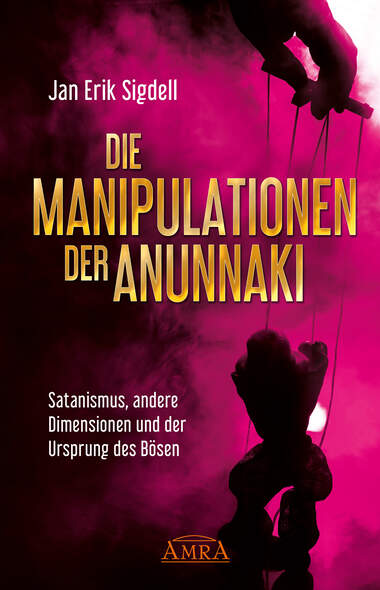
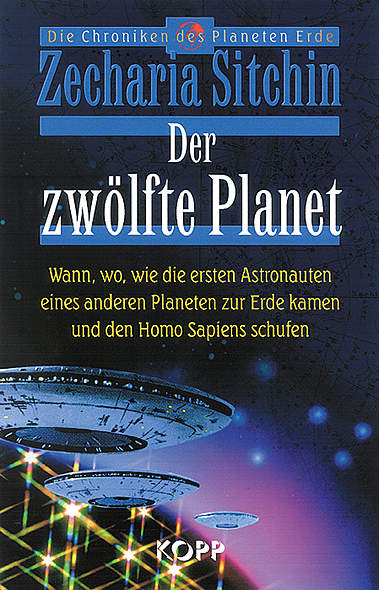

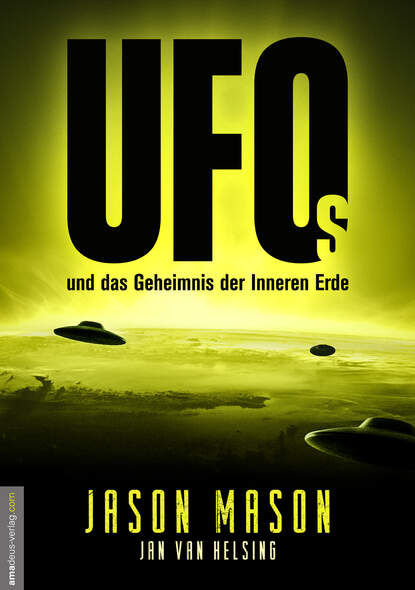


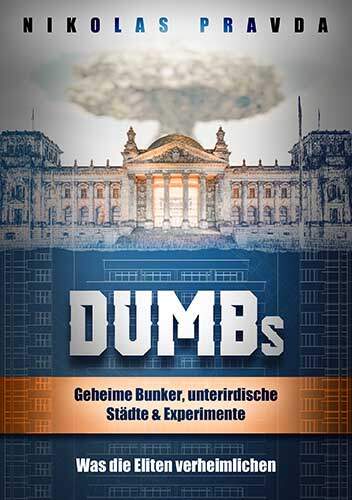
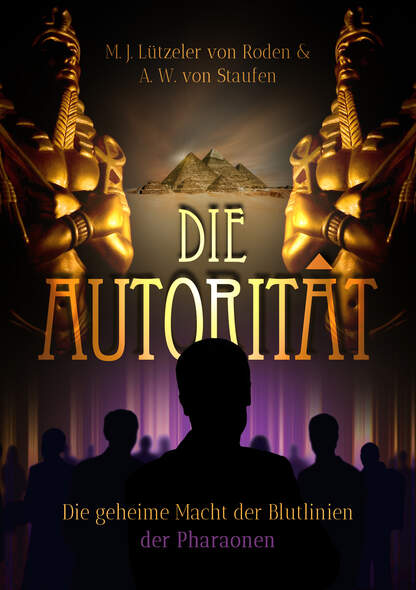

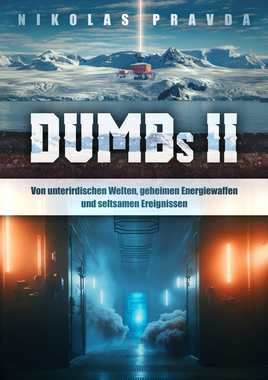
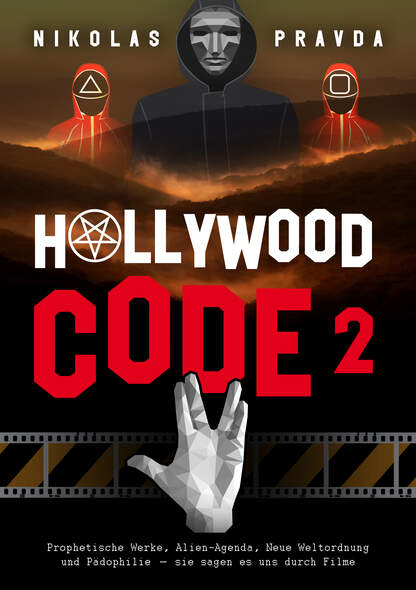
Meine Gedanken hatte ich schon mal versucht rüber zu bringen..
Unsere physikalische Raumzeitblase befindet sich so etwa wie hinter einem Ereignisshorizont. Wir können von hier drinnen unmöglich heraus denken. Anders rum dürfte es eine ganz normale Sache sein hier willentlich zu erscheinen. So genannte Wirklichkeit ist also niemals für Menschen auch nur ansatzweise greifbar, aber sie gibt es und sie organisiert 100%ig unsere Realität. Das kausale Feld ist es.
Was hier drinnen so alles abläuft ist für mich uninteressant. Hokuspokus.
Beobachtet eine Mücke. So klein und so wendig!? Die Mücke wird aus dem Feld hinter dem Ereignisshorizont gesteuert. So wie alles andere auch. Somit kann es auch keinen Tod geben. Das Informationsfeld zieht sich nur aus dem grobstofflichen Avatar zurück. Mehr nicht.
Alleine die Überschrift ist satanisch, weil sie den Schöpfer entehrt !
Worin ist der Sinn und der Nutzen zu sehen, zu wissen wie das Leben auf der Erde entstanden ist.
Stimmt. Es sind Melkanlagen.
Solche Simulationen wie Unsere.
Davon wird es unzählige geben.
Natürlich ist die Erde terraformiert, immer und immer wieder. Und das Leben entstand nicht hier auf der Erde, sondern wurde hierhin gebracht. Der Schöpfer hat die Entscheidung getroffen, weil viele Bewusstseine diesen Weg gehen wollten, ausprobieren wollten und nun sind wir auch hier. Das es so ist, steht für mich fest, die Menschheit ist von diesem Wissen aber abgeschnitten, absichtlich!!! Genau wie das Wissen von Atlantis erst gelöscht wurde, damit diese Menschheit sich auf das Wesentlich konzentriert und nicht die Belastung aus der Zeit von Atlantis ausgesetzt ist.
Nach jedem großen Reset und der letzte fand vor ca. 6000 Jahren statt, wird die Erde von den Machern und Herrschern dieser Erde neu terraformiert. Und die Menschen haben keine Ahnung davon!!!