
VPNs sind zu den letzten ungestutzten Rändern eines Internets geworden, das inzwischen für Kontrolle zurechtgestutzt wurde – die versteckten Pfade durch einen Garten, der einst eine Wildnis war.
Über Jahre wurde das Internet wie ein unkontrollierbares Buschfeuer behandelt, ein chaotischer, demokratischer Spielplatz, auf dem die Macht nicht so recht wusste, was sie tun sollte.
Heute wird es in etwas weit besser Beherrschbares umgebaut. Regierungen, die einst die Hände über dem Kopf zusammenschlugen angesichts des Online-Chaos, haben erkannt, dass sie es doch kontrollieren können – solange sie die Hand verbergen, die formt.
Was einst ein offenes Netzwerk freier Meinungsäußerung war, wird nun als „sicheres“ Netz neu vermarktet.
Die PR ist elegant. Jedes neue Regime zur Sprachkontrolle kommt mit einem weichgezeichneten Namen wie „Online Safety Act“ oder „Digital Responsibility Framework“.
Sie klingen nach Initiativen gegen Cybermobbing oder zur Entfernung von Betrugsseiten.
In Wirklichkeit geben sie Regulierern eine Schalttafel für Sprache – Werkzeuge, um zu entscheiden, was Milliarden Menschen lesen, posten oder teilen dürfen. Der Prozess wird als Moderation verkauft, doch das Produkt ähnelt stark Zensur.
Die älteste und billigste Form der Kontrolle ist DNS-Blocking, das so tut, als hätten bestimmte Websites niemals existiert. Regierungen sagen Internetanbietern, sie sollen die Auflösung von Domainnamen gesperrter Seiten stoppen – und zack, verschwinden die unerwünschten Seiten. Zensur zum Sparpreis.
Als die Türkei dies 2014 versuchte und soziale Medien blockierte, wehrte sich die Bevölkerung mit den DNS-Adressen von Google. Die Regierung blockierte diese umgehend ebenfalls – ein Beweis dafür, dass ein Staat, der gelernt hat, etwas zum Schweigen zu bringen, meist weitermacht. (Branchenführer von Proton und Nord geben zu, dass ALLE VPNs ihre Benutzer überwachen (Video))
Wer etwas Stabileres will, nutzt IP-Blocking – ein gröberes, härteres Werkzeug, das die Server selbst angreift. Es kostet mehr, wirkt aber. Die ambitioniertesten Regime gehen weiter und leiten den gesamten Datenverkehr durch staatlich kontrollierte Systeme, die jedes Datenpaket überwachen. China und Pakistan haben dies schon vor Jahren perfektioniert. Das Modell hat Fans.
VPNs sind bislang die Falltür des Internets. Sie verstecken Datenverkehr in verschlüsselten Tunneln, die durch diese Filter gleiten. Doch Regierungen holen auf.
Tools zur tiefen Paketinspektion können VPN-Aktivität manchmal erkennen – und sobald sie sie erkennen, können sie sie blockieren. Jede neue Überwachungswelle zwingt Entwickler zu neuen Tarnungen. Es ist ein endloses Rennen: eine Seite hat Gesetze, die andere Code.
Moderne Zensur braucht nicht einmal eine Geheimpolizei. Sie braucht nur App-Stores.
Die meisten Menschen erleben das Internet heute über Apple und Google. Wenn diese beiden entscheiden, dass eine App verschwinden soll, verschwindet sie sofort aus dem Leben von Millionen.
Apple hat daraus eine fein justierte Compliance-Maschine gemacht und VPN- sowie Nachrichten-Apps aus seinem chinesischen Store entfernt, um Pekings Wohlwollen zu behalten.
Google steht vor ähnlichen Forderungen, wird jedoch eher blockiert als belohnt. Beide Unternehmen beschreiben ihre Kooperation als Befolgung „lokaler Gesetze“. Dieser Satz ist die Unternehmensversion von „Ich mache nur meinen Job.“
Westliche Demokratien haben die Kunst der Kontrolle in höfliche Bürokratie verwandelt.
Australiens und Großbritanniens „Online Safety Acts“ behaupten, Bürger schützen zu wollen, schaffen aber stattdessen eine permanente Bürokratie von Sprachschiedsrichtern. Regulierer können nun Löschungen anordnen, Unternehmen bestrafen und verlangen, dass Dienste private Kommunikation auf illegale oder „schädliche“ Inhalte überwachen.
Es ist alles in juristischer Präzision verpackt, doch der Effekt ist eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Gesprächen. Verschlüsselung, einst der letzte Rückzugsort für Bürger, wird zunehmend als Hindernis für „Sicherheit“ dargestellt.
Regierungen beginnen darüber zu sprechen, VPNs zum Loggen oder Identifizieren von Nutzern zu zwingen. VPN-Entwickler wiederum bauen dezentrale Systeme, die den Verkehr wie Murmeln über einen Boden verstreuen – schwerer nachzuverfolgen, schwerer zu verbieten.
Das alte Bild der Zensur – brennende Bücher und durchtrennte Netzwerke – wurde ersetzt durch etwas Leiseres. Keine Schreie, keine großen Erklärungen, nur ein stetiger Stapel von Compliance-Schreiben und „Trust and Safety“-Richtlinien. Jede neue Regel wird als Schutzmaßnahme erklärt. Jede Schutzmaßnahme lässt weniger vom Internet unüberwacht.
Es sei angemerkt, dass man mit einem VPN immer noch ein neues App-Store- oder Play-Store-Konto in einem anderen Land registrieren kann, in dem eine App nicht verboten ist.
Theoretisch ist das ein Schlupfloch. Praktisch ist es miserabel: Regionen wechseln, Zahlungsdaten fälschen und feststellen, dass ohnehin nur Gratis-Apps herunterladbar sind. Funktioniert auf dem Papier, nicht im Leben.
Regierungen haben entdeckt, dass man Zensur durchsetzen kann, ohne Zensur zuzugeben. Statt einen Dienst direkt zu blockieren, verhängen sie Geldstrafen oder drohen mit Vermögensbeschlagnahme, bis Kooperation die sicherere Option ist.
So können sie behaupten, der Privatsektor folge lediglich „den Regeln“.
Die Europäische Union tut das mit ihren berühmten Strafandrohungen des Digital Services Act, mit denen sie Unternehmen für Datenvergehen – echte wie erfundene – abstraft. Großbritanniens Regulierer gehen weiter und verlangen, dass Unternehmen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in ihren Messenger-Apps schwächen. Die offizielle Begründung lautet „Kindersicherheit“. Das praktische Ergebnis ist erzwungener Zugang zu privater Kommunikation.
Wenn Unternehmen vor unlösbaren Compliance-Anforderungen stehen, ziehen sie sich manchmal ganz zurück.
Dies sind die sogenannten selbst auferlegten Verbote, bei denen ein Unternehmen entscheidet, dass der Dienst für eine Bevölkerung das rechtliche Risiko nicht mehr wert ist. Abgesehen von Googles langjähriger Präsenz in China sind solche Rückzüge selten. Doch wenn mehr Regierungen Hintertüren und Überwachungsbefugnisse verlangen, könnten freiwillige Rückzüge zur Normalität werden.
Ob VPNs weiterhin helfen können, hängt davon ab, wie sehr Unternehmen so tun, als würden die Sperren funktionieren. Wenn Regulierer beginnen, sie für „nachlässige Durchsetzung“ zu bestrafen, steigen die Mauern und schrumpfen die Lücken.
Die nächste Kontrollfront richtet sich direkt gegen Individuen. Einige Regierungen kriminalisieren die Nutzung bestimmter Apps und wechseln damit von Regulierung zu Strafverfolgung. In diesen Ländern gelten VPNs, die solche Gesetze umgehen, automatisch als Schmuggelware – auch wenn die Erkennung bei fortgeschrittener Verschleierung schwierig bleibt.
In mehreren Ländern haben Polizei und Soldaten begonnen, Smartphones zufällig zu durchsuchen, private Geräte zu durchwühlen, um sicherzustellen, dass keine verbotenen Apps installiert sind.
Es ist eine primitive Form der Zensurdurchsetzung, die eher auf Angst als auf Technologie setzt. Wenn Regierungen zu solchen physischen Kontrollen greifen, deutet das auf Verzweiflung hin.
Es bedeutet, dass die technischen Barrieren versagt haben und der Versuch, Informationszugang zu kontrollieren, zur politischen Inszenierung geworden ist.
Chinas Große Firewall bleibt das Kronjuwel digitaler Kontrolle. Sie vereint jedes Werkzeug im Zensurhandbuch – DNS-Blocking, IP-Filterung, Deep Packet Inspection – in einem einzigen staatlich betriebenen System.
Keiner Regierung ist es gelungen, ihren Umfang oder ihre Präzision nachzubilden.
Es gibt vereinzelte Berichte, dass bestimmte VPNs wie Proton VPN gelegentlich in China funktionieren.
Andere erwähnen Erfolge mit Tor und seinen Bridge-Relays. Nichts davon ist zuverlässig. Jeder Erfolg wird mit Dutzenden Fehlschlägen beantwortet, und jede Lösung ruft eine neue Repressionswelle hervor. Die Firewall ist nicht statisch; sie lernt, passt sich an und setzt sich durch.
Wenn alles andere scheitert, können Regierungen einfach den Stecker ziehen.
Die nukleare Option, das Internet komplett abzuschalten, existiert weiterhin. Bangladesch tat dies 2024 nach regierungsfeindlichen Protesten.
Der Blackout dauerte zehn Tage und kostete die Wirtschaft geschätzt 20 Milliarden BDT, etwa 165 Millionen US-Dollar. Der Schritt brachte Proteste zum Schweigen und legte das tägliche Leben lahm – Banken, E-Commerce und Kommunikation kamen zum Stillstand.
Online blieben nur diejenigen mit Satellitentelefonen oder internationalen SIM-Karten. Für alle anderen wurde die Welt schwarz.
Diese Abschaltungen sind selten, weil sie auch die Regierungen schädigen, die sie anordnen. Aber sie bleiben die reinste Form von Kontrolle – eine Erinnerung daran, dass jede digitale Verbindung letztlich durch Schalter läuft, die man abschalten kann.
Mit jeder neuen Zensurmaßnahme und jedem Überwachungsplan steigt der Druck auf VPNs, sich weiterzuentwickeln.
Selbst demokratische Staaten, einst stolze Verteidiger eines offenen Netzes, entwerfen nun eigene Zensur- und Überwachungsrahmen. Die Vorstellung eines grenzenlosen, vernetzten Internets verblasst jedes Jahr ein Stück mehr.
Das Ergebnis ist vorhersehbar: Das offene Internet ist zu einem umzäunten Komplex geworden – und VPNs zu unverzichtbaren Werkzeugen für alle, die den Ausgang suchen.
Allein im vergangenen Jahr meldet Proton VPN neue Nutzer in 119 Ländern, jeder Anstieg folgte neuen nationalen Netzrestriktionen.
Experten vergleichen Zensur seit Langem mit einem Katz-und-Maus-Spiel.
Regierungen erfinden neue Schlösser, Technologen neue Schlüssel – ein Spiel ohne Ende. Das führt zu einer Frage, die unter Datenschutzforschern an Bedeutung gewinnt: Sollte die Zensurumgehung ganz neue Wege gehen? Und kann sie das?
VPNs waren nie als Mittel des Widerstands gebaut. Ihr ursprünglicher Zweck war Sicherheit: Verbindungen verschlüsseln und IP-Adressen maskieren, damit Dritte Daten nicht nachverfolgen oder abfangen können. Dass diese Verschlüsselung auch Zensur umgeht, war ein Nebeneffekt, nicht das Ziel.
Im Laufe der Zeit wurde IP-Spoofing zur beliebtesten stillen Rebellion des Internets. Indem Nutzer so tun, als kämen sie aus einem anderen Land, konnten sie Sperren gegen Nachrichtenportale, soziale Medien oder Messenger umgehen.
Doch Regierungen passten sich an. Russland allein hat bereits fast zweihundert VPNs blockiert und sowohl Apple als auch Google angewiesen, sie aus lokalen App-Stores zu entfernen.
Die Repression endet nicht beim Blockieren. Neue Gesetze wurden geschaffen, die VPN-Nutzung regulieren oder kriminalisieren.
In Russland ist das Verbreiten von Informationen über Zensurumgehung inzwischen illegal.
Iran verbietet „nicht autorisierte“ VPNs und reserviert Erlaubnisse für staatlich genehmigte Dienste. Myanmars neues Cybersicherheitsgesetz zielt direkt auf sie. Die Formulierungen ändern sich, das Motiv bleibt: Netz kontrollieren, Narrativ kontrollieren.
Nicht jedes VPN ist vertrauenswürdig. Manche sind kaum mehr als Datentöpfe, betrieben von Firmen mit Verbindungen zu denselben Regimen, die zensieren. Untersuchungen haben bereits beliebte „kostenlose“ VPNs mit chinesischem Militärinteressen in Verbindung gebracht.
Proton VPN bleibt ein Frontlinien-Akteur in diesem globalen Tauziehen. Seit 2022 ist sein Stealth-Protokoll ein Maßstab für verschleierten Verkehr und kann viele der härtesten Firewalls der Welt umgehen. Das Unternehmen führte Funktionen wie ein tarnendes Android-Symbol ein, um Nutzer vor Geräteinspektionen zu schützen, und erweiterte 2024 die Stealth-Unterstützung für Windows.
Und der Bedarf wächst. Digitale Rechteorganisationen berichten von Rekordwerten an Zensur weltweit – sieben neue Länder kamen 2024 hinzu, darunter Frankreich, erstmals in einer westlichen Demokratie. Die Botschaft ist klar: Zensur ist kein regionales Problem mehr. Sie ist ein globales.
VPNs bleiben eines der wenigen Werkzeuge, die zuverlässig Löcher in digitale Mauern schlagen, doch sie sind nur ein Teil der Lösung. Verschlüsselte DNS-Dienste wie das Schweizer Quad9 kontern inzwischen DNS-basierte Sperren, während das Tor-Projekt weiter seine „pluggable transports“ verfeinert.
Tors neueste Innovationen, WebTunnel und Snowstorm, tarnen verschlüsselten Verkehr als normalen Web-Browsing-Datenstrom, was Erkennung erschwert und Unterdrückung teurer macht.
Das Rennen zwischen Zensoren und Ingenieuren geht weiter, mit steigenden Einsätzen. Das offene Internet schrumpft – aber der Wille, es am Leben zu halten, nicht. Solange Menschen entschlossen sind, verbunden zu bleiben, wird es jene geben, die die Werkzeuge bauen, die es ihnen ermöglichen.
Die VPN-Branche gerät in Panik, weil sie weiß, dass ihre Tage gezählt sind.
Die Zukunft des Datenschutzes hängt nicht von Versprechen ab – sondern von Beweisen. Die Entwicklung der Computertechnik hat sich schon immer in Richtung Verifizierung entwickelt. Und jetzt holen VPNs endlich auf …
Werden Sie Teil der neuen Generation des Datenschutzes bei VP.net – schützen Sie für nur fünf Dollar im Monat, was Ihnen gehört.
Vertrauen Sie nicht. Überprüfen Sie. Denn die neue Ära gehört den Beweisen – nicht der Propaganda.
Schließen Sie sich der Revolution unter VP.net an – und übernehmen Sie wieder die Kontrolle.
Quellen: PublicDomain/reclaimthenet.org am 20.11.2025










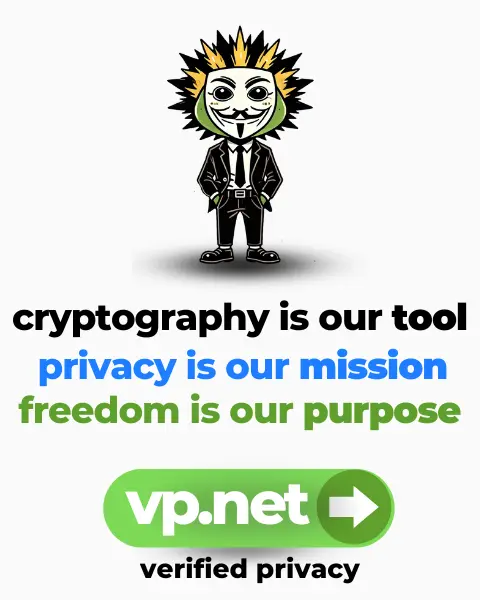
Wer denkt das VPN sicher sind, der irrt sich gewaltig. Diese sind nichts weiteres als ein gefundenes Fressen der Überwacher, die den Code schon bei Gründung der VPNs forderten, weil die wussten, das dort leicht was zu holen ist.Jeder der sich dort einloggt ist sofort verdächtig, Punkt.
Bitte wacht endlich auf!
Es gibt nichts sicheres für uns………..
VPN war nie für Sicherheit und vor allem Anonymität ausgelegt. Wer solche Märchen glaubt, hat 0 Ahnung von der Materie
Ist youtube kaputt ?