
Aus der Perspektive des Washington des 21. Jahrhunderts mag die Französische Revolution von 1789 wie ein weit zurückliegendes historisches Ereignis erscheinen.
Doch ihre Lehren sind nach wie vor von großer Relevanz. Selbst kluge Zeitgenossen wie Benjamin Franklin und Friedrich der Große sahen die Umwälzungen, die Frankreich und die Welt verändern sollten, nicht voraus. Von Douglas Macgregor
Dieses Versäumnis erinnert uns daran, dass Revolutionen oft aus komplexen, manchmal subtilen sozialen Dynamiken entstehen – vor allem aus der weit verbreiteten öffentlichen Empörung über eine herrschende Klasse, die als dekadent, unzusammenhängend und unverantwortlich wahrgenommen wird.
Im Jahr 1789 richtete sich ein Großteil der revolutionären Begeisterung gegen die französische Aristokratie, deren protziger Reichtum und moralische Verfehlungen weithin bekannt und verachtet waren.
Pamphlete und geheime Zeitschriften deckten nicht nur ihre persönlichen Laster auf, sondern auch die desolate Lage der Staatsfinanzen – eine erdrückende Schuldenlast, die größtenteils durch verschwenderische Ausgaben und kostspielige Kriege im Ausland, darunter die Unterstützung der Amerikanischen Revolution, entstanden war.
Heute sind die Amerikaner mit ihren eigenen Ängsten vor der Macht und Verantwortlichkeit der Elite konfrontiert. Der Skandal um Jeffrey Epstein endete nicht mit seinem Tod in einem Bundesgefängnis; er weitete sich aus. (Trump und Putin: Der Schachzug gegen Europa)
Die nicht versiegelten Flugprotokolle, der umstrittene Deal von 2008 und die unerklärliche Nachsicht der aufeinanderfolgenden Regierungen deuten auf eine parteiübergreifende Schutzgelderpressung hin, die ein Netzwerk schützt, das sich von Clintonworld über Silicon Valley bis nach Mar-a-Lago erstreckt, wie die investigative Journalistin Julie K. Brown dokumentiert hat.
Präsident Donald Trumps Verbindung zu Epstein – die sich auf überlappende soziale Kreise in den 1990er Jahren und ein Zitat des New York Magazine aus dem Jahr 2002 beschränkt, in dem Epstein als „toller Kerl“ bezeichnet wurde – ist kein Beweis für Kriminalität. Aber sie ist ein Beweis für ein Klassenproblem.
Wenn sich der gesellschaftliche Kalender der herrschenden Elite mit dem eines verurteilten Sexualstraftäters überschneidet, ziehen die Wähler unweigerlich Rückschlüsse auf die moralische Verfassung der Machthaber.
Wie Matt Taibbi in Griftopia (2010) feststellte , schützen die amerikanischen Medien die Reichen oft vor direkter Kritik, sofern keine rechtlichen Konsequenzen drohen.
Epsteins Fall, der durch seine Verbindung zu Trump noch verschärft wurde, hat daher einen besonders empfindlichen Nerv getroffen und das tiefe Misstrauen vieler Amerikaner gegenüber einer Elite offengelegt, die als über dem Gesetz stehend wahrgenommen wird.
Unterdessen sind viele Amerikaner, die Trump unterstützten, zunehmend besorgt. Bislang sind trotz verwirrender Aussagen von Politikern wie Justizministerin Pam Bondi weder Anklagen noch schwere Strafverfahren eingeleitet worden.
Doch die Erinnerung an Kontroversen wie die Affäre um Hunter Bidens Laptop lässt manche fragen, ob sich die politische Landschaft mit der Wahl 2024 nicht nur verändert hat, sondern auch ihre Richtung.
Trumps Wählern wurde mehr versprochen als nur sichere Grenzen. Erfahrene Grenzschutzbeamte erwarteten eine umfassende Strategie, bei der die US-Streitkräfte die nationalen Grenzen, den Luftraum und die Gewässer aktiv überwachen und sichern – und so die Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung unterstützen. Doch ein klarer, nachhaltiger Plan fehlt bislang.
In der Außenpolitik versprach Trump, kostspielige Militärinterventionen ohne strategischen Nutzen für die amerikanische Bevölkerung zu beenden. Trump hat in fünf Monaten so viele Luftangriffe durchgeführt wie Biden in vier Jahren
Stattdessen setzte seine Regierung eine Politik fort und baute sie aus, die der der Biden-Regierung ähnelt, darunter Stellvertreterkonflikte mit Russland und eine zurückhaltende Reaktion auf die humanitäre Krise im Gazastreifen. Israels regionale Ambitionen drohen die USA in einen langwierigen Konflikt zu verwickeln, der finanzielle und materielle Ressourcen erschöpfen würde.
Die Erwartungen, verschwenderische Auslandsausgaben zu reduzieren und das Militär auf die Verteidigung der Hemisphäre zu konzentrieren, haben sich weitgehend nicht erfüllt.
Die Einwanderung war ein weiterer Eckpfeiler von Trumps Wahlkampf. Die Wähler erwarteten entschlossene Maßnahmen zur Ausweisung von Millionen illegaler Einwanderer, die aufgrund ihrer Fähigkeiten in Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen oder Mathematik nicht einreisen durften.
Viele glauben, die Politik der offenen Grenzen der Biden-Regierung zielte darauf ab, eine politische Basis aufzubauen, die die Dominanz der Linken in Washington, D.C. festigen könnte – eine Dominanz, die sich allein durch Wahlen nur schwer umkehren ließe.
Während niemand mit einer Lösung über Nacht rechnete, erwarteten Trumps Anhänger eine ernsthafte Strategie. Der Präsident ist befugt, Bundesmarschälle und die Nationalgarde einzusetzen, um die illegale Einwanderung systematisch zu bekämpfen, doch ein solch umfassender Plan ist bisher nicht entstanden.(In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)
Trumps jüngste Bereitschaft, Millionen von Menschen zu amnestieren, hat zudem viele seiner Anhänger beunruhigt. Sie sehen darin einen Verrat an zentralen Versprechen und eine Bedrohung für die Zukunft der amerikanischen Republik.
Wirtschaftlich spüren die Amerikaner täglich die Auswirkungen von Inflation, Einwanderung und wirtschaftlicher Unsicherheit.
Der Status des Dollars als Weltreservewährung ermöglichte es US-Regierungen lange Zeit, eine expansive Finanzpolitik relativ ungestraft zu verfolgen. Dennoch hofften viele, Trump würde diesen Trend eindämmen.
Diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Das Scheitern von Initiativen wie dem Department of Government Efficiency (DOGE) sowie die Defizite früherer Bemühungen wie dem Simpson-Bowles-Plan und der Grace Commission unterstreichen das Fortbestehen der Defizitausgaben.
Die kürzliche Verabschiedung des sogenannten One Big Beautiful Bill signalisiert die anhaltende Bereitschaft, die Bundesausgaben zu erhöhen, anstatt sie zu kürzen.
Heute liegt die US-Schuldenquote bei über 120 Prozent – fast doppelt so hoch wie vor der Finanzkrise 2008. Steigende Renditen auf US-Staatsanleihen deuten darauf hin, dass Washington in eine gefährliche Schuldenspirale geraten könnte. Finanzexperten wie Jamie Dimon von JP Morgan warnen vor einem möglichen „Riss im Anleihemarkt“, der eine Neuordnung der Weltwirtschaftsordnung auslösen könnte.
Gleichzeitig kündigt das Aufkommen der BRICS-Staaten als mögliche währungspolitische Alternative nach Bretton Woods eine weitere mögliche Verschiebung der globalen Machtdynamik an.
Kurz gesagt: Washington steuert auf eine Staatsschuldenkrise, eskalierende Kriege im Ausland und potenzielle Unruhen im Inland zu, ohne einen klaren Weg vor Augen zu haben.
Präsident Trump hat diese Herausforderungen zwar nicht allein geschaffen, trägt aber nun die Verantwortung, sie zu bewältigen. Seine Wahlversprechen von Rechenschaftspflicht, Transparenz und Haushaltsreformen wurden bislang nicht eingelöst. Die Verantwortung liegt bei seiner Regierung.
Der Fall Epstein – ob kurze Ablenkung oder Vorbote tieferer Turbulenzen – unterstreicht die Fragilität des öffentlichen Vertrauens.
Der Zusammenbruch der französischen Monarchie und die darauffolgende Revolution lösten jahrelange Gewalt und Chaos aus. Nur wenige Amerikaner wünschen sich, dass sich hier etwas Ähnliches abspielt.
Trump wäre gut beraten, den Vertrauensverlust in seine Regierung und die gesamte politische Klasse nicht als vorübergehende Phase abzutun.
Vielfältige, multikulturelle Gesellschaften wie die unsere erfordern eine sorgfältige Verwaltung, um den sozialen Zusammenhalt zu bewahren. Die aufrührerische Gewalt des Sommers 2020 und die dahinter stehenden Kräfte sind nicht verschwunden.
Über weite Teile der amerikanischen Geschichte hinweg war sich der Durchschnittsbürger der komplexen Kämpfe jenseits der US-Grenzen oder innerhalb des Washingtoner Stadtgebiets nicht bewusst.
Doch Epsteins Nähe zu Trump hat über die Vorwürfe hinaus einen Nerv getroffen – sie verdeutlicht die tiefe Angst vor der Macht der Eliten und dem moralischen Verfall.
Wie die Pariser von 1789 reagieren die Amerikaner mit Nachdruck auf Appelle, die Tugend ehren und Laster verurteilen. Es wäre ein schwerer Fehler, wenn Trump die Auswirkungen des Epstein-Skandals ignorieren würde, zumal dieser mit dem Versagen seiner Regierung bei der Erfüllung wichtiger Wahlkampfversprechen zusammenfällt.
Für Konservative, die sich für Ordnung, Freiheit und nationale Erneuerung einsetzen, ist der Weg klar. Die Führung muss das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherstellen, indem sie den Exzessen der Elite entgegentritt, Grenzen sichert, sinnlose Kriege beendet und für Haushaltsdisziplin sorgt.
Nur so kann Amerika das Schicksal von Versailles am Potomac vermeiden.
Über den Autor: Douglas Macgregor, Oberst (im Ruhestand), ist Senior Fellow bei The American Conservative , ehemaliger Berater des Verteidigungsministers in der Trump-Administration, CEO von Our Country Our Choice, dekorierter Kriegsveteran und Autor von fünf Büchern.
Quellen: PublicDomain/theamericanconservative.com am 03.08.2025




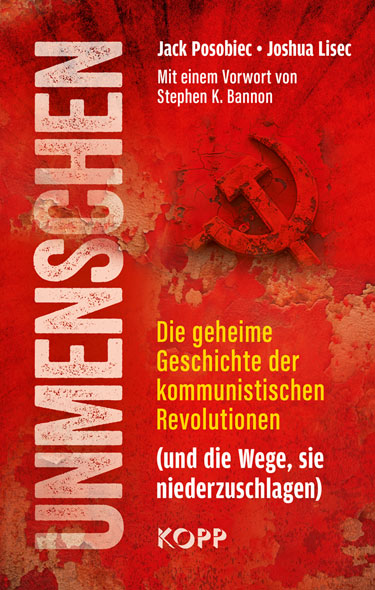

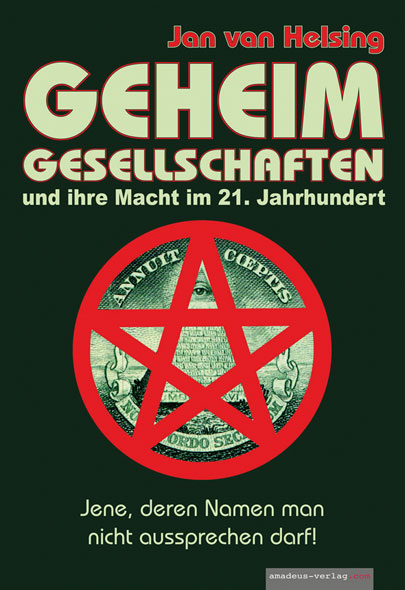
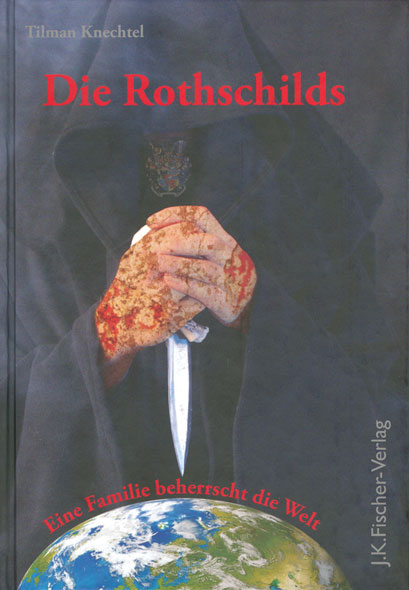


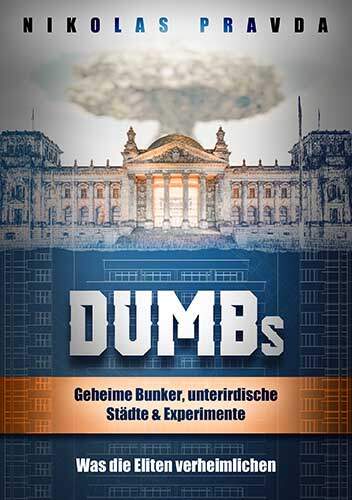
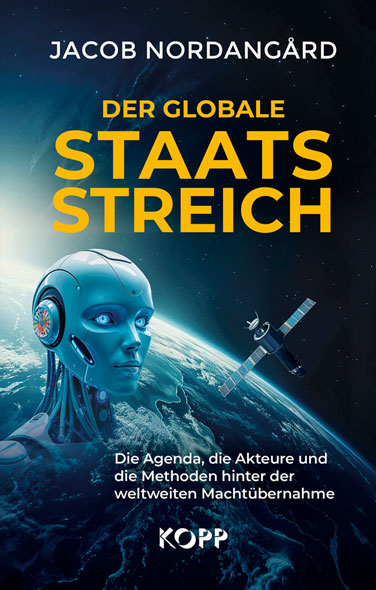

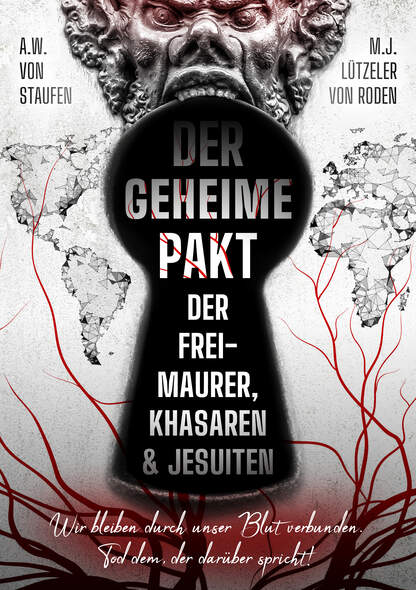
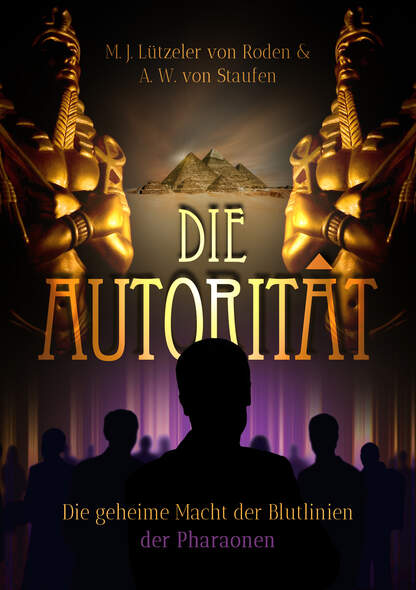
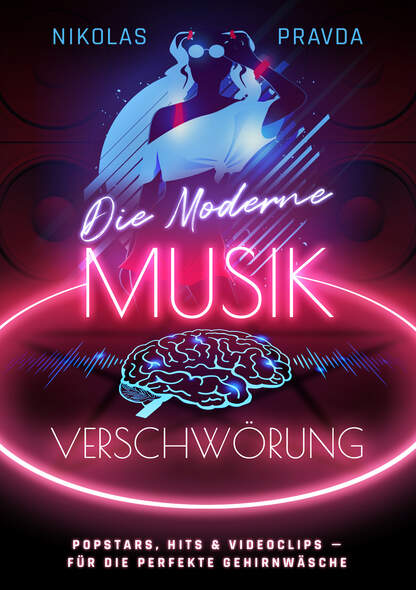
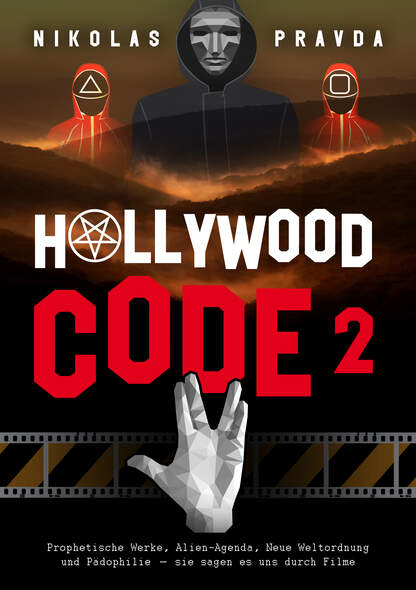

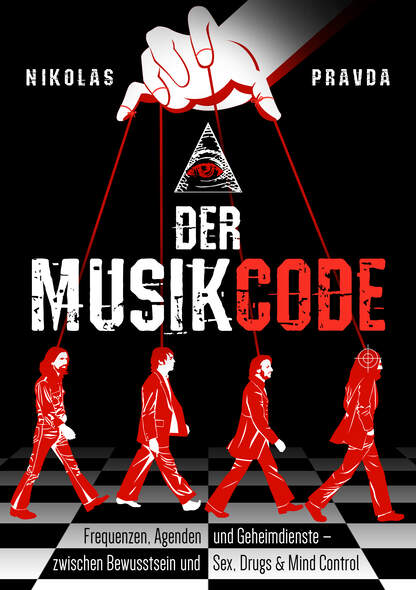
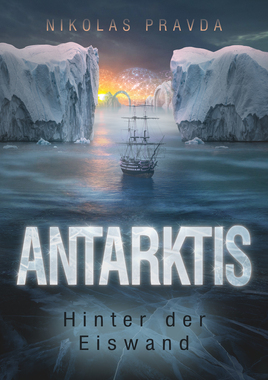
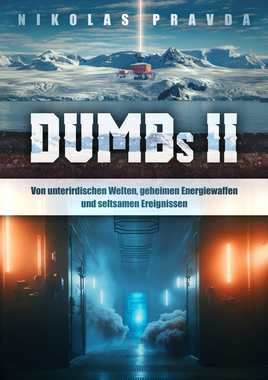

keine unwichtige Person diese Douglas Macgregor….
Denke er kann das schon ganz gut einschätzen.