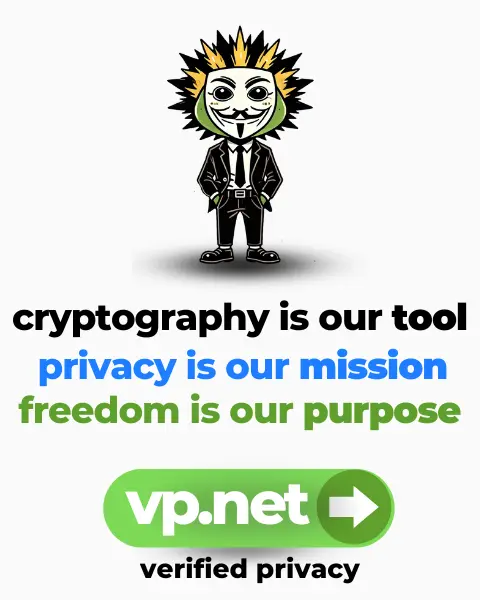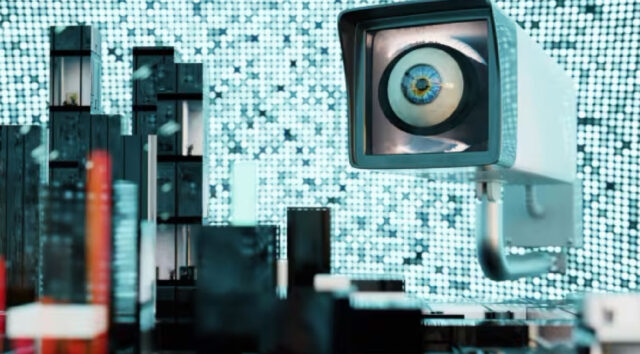
George Orwell lässt grüßen: Die Schweiz droht ein autoritärer Überwachungsstaat zu werden.
Geht es nach dem Willen des Bundesrats, müssen sich Internetnutzer in der Schweiz künftig mit Ausweis identifizieren. Die Anonymität im Internet würde der Geschichte angehören.
Wer eine Schweizer App oder Plattform nutzt, riskiert, identifiziert zu werden. Schon jetzt ist klar: Die geplanten Maßnahmen sind ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte. Von Frank Schwede
Da braut sich was zusammen. In der Schweiz, die bekannt ist für ihre Verschwiegenheit, zumindest im Bankensektor, droht die Überwachung aus dem Ruder zu laufen.
Wenn es nach den Bürokraten des Bundesrats geht, wird die digitale Massenüberwachung vielleicht schon im kommenden Jahr per Verordnungsweg massiv ausgebaut. Dann müssen sich alle Internetnutzer in der Schweiz mit Ausweis oder Telefonnummer identifizieren.
Tech-Journalistin Adrienne Fichte fand für dieses Vorhaben genau die passenden Worte. Sie schreibt in einem Artikel für Republik.ch: „Die Vorlage klingt, als wäre sie vom Kreml höchstpersönlich verfasst worden.“
Geplant ist, dass sämtliche digitale Dienste mit mindesten 5000 Nutzern – egal ob sie E-Mail, Cloud, VPN oder Chat anbieten, die Daten ihrer Nutzer ausreichend identifizieren und speichern. Allerdings nur mit reduzierten Pflichten. Vollumfänglich greifen die erst ab einer Million Usern.
Auf den Punkt gebracht heißt das, dass jede Website, über die sich Personen Direktnachrichten zukommen lassen können, unter diese Bestimmung fiele. Bislang galten die Überwachungspflichten vor allem für große Telekommunikationsunternehmen wie Swisscom, Sunrise oder Salt.
Viele kleine Unternehmen leisten bereits heftigen Widerstand. So wie Proton-CEO Andy Yen. Er lehnt die Änderungen kategorisch ab. In einem Videocall mit Blick.ch sagte Yen:
„Wir werden die Änderungen unter keinen Umständen mittragen. Sollten sie dennoch in Kraft treten, verweigern wir die Zusammenarbeit. Und wenn der Bund uns zum Gehorsam zwingen will, verlegen wir unseren Firmensitz ins Ausland.“
Als Grund nannte Yen anstehende Kosten in Höhe von mehreren Millionen Schweizer Franken. Damit wäre sein Unternehmen gegenüber der Konkurrenz aus den USA und der EU weniger wettbewerbsfähig.
Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen hätte die vom Bund geplante Teilrevision massive negative Folgen, kritisiert Jon Fanzun vom IT-Branchenverband SWICO. Er sagt:
„Die vorgeschlagene Revision ist in weiten Teilen weder verhältnismäßig noch gesetzeskonform. Sie stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Freiheitsrechte dar, bringt sicherheitspolitisch keinen Mehrwert, schwächt den Wirtschafts- und Innovationsstandort Schweiz und verursacht unnötige Mehrkosten und Bürokratie für die betroffenen Unternehmen.“
Totalüberwachung durch die Hintertür
In der Regel entscheidet bei der Einführung neuer Gesetze das eidgenössische Parlament. Doch in diesem Fall will der Bund die neuen Überwachungsmaßnahmen auf dem Verordnungsweg einführen. Also durch die Hintertür.
Schon jetzt stellt sich für die „Digitale Gesellschaft Schweiz“ die vielleicht alles entscheidende Frage, ob ein solch tiefgreifender Einschnitt ohne National- und Ständerat überhaupt legitim ist. Von Seiten der Gesellschaft heißt es:
„Die Regelungen gehören zwingend in ein Gesetz, müssen vom Parlament erlassen und einer demokratischen Legitimation mittels Referendum unterstellt werden. Der Versuch, dermaßen weitreichende Überwachungspflichten auf dem Verordnungsweg einzuführen, stellt einen klaren Verstoß gegen das Legalitätsprinzip dar und untergräbt die Kompetenzordnung.“
Auch die „Internet Society Schweiz“ hat erhebliche Bedenken und warnt, dass jedes zusätzliche Speichern von Daten das Risiko für deren Missbrauch erhöht. Weiter heißt es, dass Metadaten detaillierte Einblicke in Kommunikationspartner, Standorte und Gewohnheiten lieferten und dass die verpflichtende Vorratsdatenspeicherung nicht nur eine Massenüberwachung ermöglicht, sondern auch den unrechtmäßigen Zugriff Dritter auf Daten.
Für die Identifizierung müssten laut Adrienne Fichte Nutzer eine Ausweiskopie oder Telefonnummer vorlegen, die mit der SIM-Kartenregistrierung an eine Ausweiskopie gekoppelt sei. Sie schreibt:
„Diese Kundeninformationen müssten all Unternehmen sechs Monate auf Vorrat speichern. Die St. Galler Strafrechtsprofessorin Monika Simmler bezweifelt, dass diese Vorgaben überhaupt noch dem Bundesgesetz einsprechen.“
Wer ist für den großen Lauschangriff verantwortlich? In diesem Fall das EJPD, das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartment, das unter der Leitung des SP-Bundesrates Beat Jans steht, dem der Dienst des ÜPF (Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr) unterstellt ist.
Das EJPD ist eine unabhängige Bundesbehörde mit besonderen Aufgaben, denn die Bundesangestellten überwachen vor allem die Kommunikation von Personen, die einer schweren Straftat verdächtigt werden. Selbstverständlich im Auftrag der Strafverfolgungsbehörden.
Hier geht es um Zugang zu verschlüsselten Messengerdiensten, die als absolut abhörsicher gelten. Strafverfolgungsbehörden und der Nachrichtendienst des Bundes können nach richterlicher Genehmigung einen Staatstrojaner installieren, um verschlüsselte Chats nachzuverfolgen.
Das EJPD betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass die Revision der Verordnung nicht dazu führen werde, den Überwachungsapparat auszubauen. Ein Sprecher des Dienstes sagte: „Die meisten Unternehmen werden nie von uns hören und sammeln sowieso schon Daten.“
Vertrauen geht verloren
Auch wenn die breite Masse von der Revision nicht direkt betroffen ist, die Metadaten, aus denen deutlich hervorgeht, wer mit wem zu welcher Uhrzeit gechattet hat, sind nachvollziehbar.
Eine Trennung zwischen Fernmeldedienstanbietern und Kommunikationsdiensten hatte das Parlament bei der ersten Revision des Bundesgesetzes zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vor zehn Jahren bewusst eingeführt, um KMU-Unternehmen nicht unnötig zu belasten.
Das würde sich bei der zweiten geplanten Revision ändern. Und genau das bereitet dem IT-Branchenverband Unbehagen, weil die Schweiz als Wirtschaftsstandort unter großem Wettbewerbsdruck steht und die neue Regelung diesen schwächen würde.
Grund ist, dass die betroffene Dienste im Bereich Datensicherheit vom Vertrauen und vor allem der Rechtssicherheit leben. Bislang profitiert die Schweiz im In- und Ausland von ihrem Ruf als sicherer Hafen für den Datenverkehr. Das könnte sich nun bald ändern.
IT-Anwalt Jonathan Messmer von der Kanzlei Ronzani/Schlauri sagt, dass im Extremfall Strafverfolgungsbehörden alle fünf Sekunden eine automatisierte Anfrage an Unternehmen mit vollen Überwachungspflichten stellen und in Echtzeit alle soeben registrierten Zugriffe rausholen können, um eine ganze Historie aufzubauen.
Sollten durch die neue Regelung innovative Firmen aus der Schweiz abwandern, wäre dies ein herber Verlust für die Alpenrepublik. Gerade jetzt, wo in Europa eine Abkehr von dem marktbeherrschenden US-Tech-Konzernen stattfindet.
Viele Beobachter fürchten sogar, dass durch die neue Regelung künftig US-Unternehmen wie Meta noch mächtiger werden könnten. Für Marktführer wie WhatsApp gelten die Schweizer Gesetze nicht.
Das heißt, die geplante Änderung betrifft und bestraft nur Schweizer Anbieter. Die geplante Ausweitung der Überwachung sorgt nicht nur in der Schweiz für kontroverse Diskussionen, sondern auch in Deutschland und anderen Ländern.
Der erste Anlauf für die geplante Änderung wurde bereits während Corona gestartet. In einem im Jahr 2022 veröffentlichten Entwurf forderten die Verantwortlichen die komplette Abschaffung der Verschlüsselungsdaten für viele Kommunikationsdienste. Medien sprachen von einer Schweizer Version der EU-Chatkontrolle. Tech-Journalistin Adrienne Fichter schreibt dazu:
„Man musste davon ausgehen, dass eine technische Hintertür bei Messenger-Apps wie Threema eingebaut werden sollte für einen direkten Zugang für Strafermittler, wie seit Jahren in der EU diskutiert wird.
Ein Aufschrei in den Medien sorgte dafür, dass der Bund diesen umstrittenen Teil verschob und nur den weniger kontroversen Teil in Kraft treten ließ.“
Das Monster in letzter Minute stoppen
Proton und Threema haben sich in der Vergangenheit bis vor das Bundesgericht mit Erfolg gegen die Verschärfung geplanter Überwachungsmaßnahmen gewehrt. Somit liegt die Vermutung nahe, dass der Bund über den Verordnungsweg versucht, ein juristisches Hickhack zu vermeiden. Das ist ein demokratiepolitisch höchst fragwürdiges vorgehen, meint Adrienne Fichte.
Sollte der Bund diesmal Erfolg haben, würde das dass komplette Ende der Anonymität im Internet bedeuten und jeder, der eine Schweizer App, Software oder Plattform nutzt, riskiert gläsern und identifizierbar zu sei, so Adrienne Fichter.
Das kann zukünftig weitreichende Folgen haben. Wenn nämlich datenschutzfreundliche Anbieter vom Markt verschwinden, verlieren Internetnutzer den Zugang zu sicheren und vertraulichen Kommunikationsmitteln.
Das beträfe auch Journalisten, Anwälte und Ärzte. Auf diese Weise werden elementare Grundrechte ignoriert. National und international garantierte Menschenrechte wie der Schutz der Privatsphäre und die informelle Selbstbestimmung stehen auf dem Spiel.
Eine Ausweitung der Überwachung von solch erheblicher Tragweite darf nicht auf Verordnungsstufe geregelt werden. Die geplanten Regelungen gehören zwingend in ein Gesetz, müssen von einem Parlament erlassen und einer demokratischen Legitimation mittels Referendum unterstellt werden.
Der Versuch, eine dermaßen weitreichende Überwachung per Verordnungsweg einzuführen, ist ein klarer Verstoß gegen das Legalitätsprinzip und untergräbt die Kompetenzordnung.
Die „Digitale Gesellschaft Schweiz“ und andere Kritiker schlagen das sogenannte Quick-Freeze-Modell als Alternative zur pauschalen Vorratsdatenspeicherung vor. In Rahmen dieses Modells werden Kommunikationsdaten nicht massenhaft und ohne Anlass gespeichert, sondern nur bei konkretem Verdacht und auf richterliche Anordnung gezielt gespeichert.
Bis zum 6. Mai hatten alle Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen die Möglichkeit, eine entsprechende Stellungnahme zur geplanten Revision beim Bundesrat einzureichen.
Nun wertet das EJPD die Eingaben aus, überarbeitet den Text und legt ihn dem Bundesrat vor. Wird die Verordnung wie geplant beschlossen, könnte sie bereits 2026 in Kraft treten. Es sei denn, das Monster wird noch in letzter Minute gestoppt.
Wie es aussieht, plant die Schweiz mit dieser Revision einen riesigen Überwachungsapparat auf die Beine zustellen, damit Behörden quasi auf Knopfdruck unbegrenzt Auskünfte abfragen können.
Auf internationaler Ebene lässt sich die geplante Verordnung nur mit autoritären Staaten wie China und den Iran vergleichen. Unabhängig von der Schweiz weht aber auch in anderen Ländern Internetnutzern längst ein rauer Wind um die Nase.
Republik.ch schliesst die Analyse wie folgt:
Die Schweiz sabotiert ihre eigene IT-Industrie damit in einem Moment, wo sie sie am stärksten braucht: in geopolitisch turbulenten Zeiten, in denen die Privacy-Tech-Branche extremen Zulauf erhält und hiesige Cloud-Unternehmen wie Infomaniak auf Plakaten mit «sichere Schweizer Cloud» werben.
Gerade jetzt, wo Bundesbern damit beginnt, sich Gedanken zur digitalen Souveränität zu machen und zur Loslösung von Big-Tech-Konzernen. Und gerade jetzt, wo bereits zwei Kantone ein «Recht auf digitale Integrität» und damit auch Anonymität in ihren Verfassungen verankert haben und in weiteren Kantonen politische Debatten dazu angelaufen sind.
Die Ironie dabei: Mit dieser Verordnung werden amerikanische Big-Tech-Konzerne wie Meta noch mächtiger. Denn für Whatsapp – wie der Sprecher des Diensts Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr bestätigt – gelten die Schweizer Gesetze nicht.
Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 13.08.2025