
Auf dem jüngsten Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin signalisierten Staats- und Regierungschefs, die mehr als die Hälfte der Menschheit repräsentieren, den Aufstieg einer multipolaren Weltordnung. Während China, Russland, Indien und Zentralasien neue Finanz- und Handelssysteme vorantreiben, läuft der Westen Gefahr, außen vor zu bleiben. Von Prof. Ruel F. Pepa
Titelbild: Der russische Präsident Wladimir Putin, der indische Premierminister Narendra Modi und der chinesische Staatschef Xi Jinping beim SCO-Gipfel. (GODL-Indien)
Als sich die Staats- und Regierungschefs Chinas, Russlands, Indiens und mehrerer zentralasiatischer Staaten letzte Woche in Tianjin zum Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) trafen, hätte die Welt deutlich aufmerksamer sein sollen.
Die am Tisch vertretenen Länder stellen zusammen mehr als die Hälfte der Menschheit, verfügen über immense Rohstoffreserven und erwirtschaften einen immer größeren Anteil des globalen BIP. Es handelt sich hier nicht um eine Randkoalition, sondern um eine tragende Säule des entstehenden internationalen Systems.
Dennoch behandelte ein Großteil der westlichen Presse das Treffen als eine diplomatische Nebenschau, die von innenpolitischen Debatten oder den neuesten Nachrichten der NATO überschattet wurde. Das war ein Fehler. Was sich in Tianjin abspielte, war nicht nur ein weiterer regionaler Gipfel.
Es war der bisher deutlichste Hinweis darauf, dass die unipolare Welt der US-amerikanischen Vorherrschaft, die die Jahrzehnte nach dem Kalten Krieg dominierte, einer neuen und umstrittenen multipolaren Ordnung weicht.
Die Symbolik war unmissverständlich. Peking positionierte die SCO als Plattform für eine „gleichberechtigte Partnerschaft“ und stellte sie damit implizit in Gegensatz zu westlichen Allianzen, die auf Hierarchie und US-Führung basierten. Moskau betonte angesichts westlicher Sanktionen und militärischen Drucks strategische Koordination.
Indien, das seine Beziehungen zu Washington sorgfältig ausbalancierte, betonte seine Rolle als zivilisatorische Macht, die einen unabhängigen Weg einschlägt. Die zentralasiatischen Republiken, lange Zeit als geopolitisches Schlachtfeld zwischen fremden Mächten betrachtet, betonten ihre Bedeutung als Bindeglieder in Handel, Energie und Sicherheit in ganz Eurasien. (Putin: Die koloniale Erpressung funktioniert nicht mehr)
Über die Symbolik hinaus hatte der Gipfel auch Substanz. Vereinbarungen über Energiekooperation, grenzüberschreitende Infrastruktur, digitale Technologien und Sicherheitskoordination deuten auf einen zunehmend institutionalisierten Block hin. Zusammengenommen signalisieren sie, dass sich die SCO von einem losen Forum zu einem Rahmen entwickelt, der die Regeln der Welt des 21. Jahrhunderts prägen kann.
Für die politischen Entscheidungsträger in Washington und den europäischen Hauptstädten ist die Lektion ernüchternd. Wer die SCO ignoriert oder als Diskussionsforum abtut, läuft Gefahr, die Konsolidierung eines alternativen Machtzentrums zu übersehen, das auch außerhalb westlicher Institutionen zunehmend an Legitimität gewinnt.
Für den Rest der Welt, insbesondere in den Entwicklungsländern, war Tianjin eine Erinnerung daran, dass Macht nicht mehr an einem einzigen Pol konzentriert ist, sondern auf mehrere Hauptstädte mit unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen verteilt ist.
Der Gipfel war daher mehr als nur ein diplomatischer Kalendereintrag. Er war ein Meilenstein in der langsamen, aber unübersehbaren Neuausrichtung der globalen Machtverhältnisse und ein Prozess, der die internationale Politik für die kommenden Jahrzehnte prägen wird.
Eine neue Architektur entsteht
Der chinesische Präsident Xi Jinping nutzte den Gipfel, um seine Vision einer Welt zu propagieren, in der die Mentalität des Kalten Krieges der Vergangenheit angehört. Seine Bemerkungen waren keine bloßen diplomatischen Höflichkeitsfloskeln; sie waren eine direkte Kritik am US-geführten Bündnissystem und dessen Vertrauen auf Abschreckung, Sanktionen und Blockpolitik.
Mit der lautstarken Unterstützung Wladimir Putins versprach Xi, den Aufbau einer multipolaren Ordnung zu beschleunigen, in der die westliche Dominanz durch neue Machtzentren in Eurasien und darüber hinaus eingedämmt würde [1].
Was Tianjin von früheren Gipfeln unterschied, war die Verknüpfung dieser Aufrufe mit konkreten Initiativen. Peking stellte eine Zehnjahresstrategie für die SCO vor, die mit Milliarden von Dollar an Krediten und Zuschüssen für Infrastruktur, Energiekorridore und digitale Konnektivitätsprojekte untermauert ist [2].
Dieser Rahmen geht weit über ambitionierte Kommuniqués hinaus: Er signalisiert den gezielten Versuch, die SCO sowohl als wirtschaftliche als auch als geopolitische Kraft zu institutionalisieren.
Einer der kühnsten Vorschläge war die Schaffung einer eigenen SCO-Entwicklungsbank, die eine explizite Herausforderung für die Bretton-Woods-Institutionen, insbesondere IWF und Weltbank, darstellt. Ein solches Gremium würde es den SCO-Mitgliedern ermöglichen, Projekte ohne die von westlichen Kreditgebern oft auferlegten Auflagen zu finanzieren.
Es würde zudem andere von China geführte Initiativen wie die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank (AIIB) und die Belt and Road Initiative ergänzen und sie in ein breiteres eurasisches Finanzökosystem einbinden.
Die Auswirkungen sind weitreichend. Jahrzehntelang war die globale Finanzordnung von Institutionen mit Sitz in Washington und Brüssel geprägt, die die Entwicklung der südlichen Hemisphäre prägten. Indem sie alternative Kapitalquellen anbieten, signalisieren Peking und seine Partner, dass das Monopol westlicher Finanzpolitik zu Ende geht. Die geplante Bank der SCO würde nicht nur Eisenbahnen, Pipelines und Glasfasernetze in ganz Eurasien finanzieren, sondern auch symbolisch finanzielle Souveränität demonstrieren.
Die Botschaft aus Tianjin war eindeutig: Die Institutionen des Westens werden nicht länger unangefochten bleiben. Es entsteht eine parallele Architektur, die die Prioritäten Pekings, Moskaus, Neu-Delhis und der Hauptstädte Zentralasiens widerspiegelt. Noch ist unklar, wie einheitlich und dauerhaft sich diese Architektur erweisen wird, doch ihre bloße Existenz unterstreicht, dass die Welt die Unipolarität hinter sich gelassen hat.
Der Streit dreht sich nicht mehr darum, ob der Westen herausgefordert wird, sondern darum, wie schnell alternative Institutionen konsolidiert werden können und wie effektiv sie ihre Ziele erreichen können.
Zentralasien im Zentrum
Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit positioniert Zentralasien zunehmend als Rückgrat der entstehenden multipolaren Welt. Weit davon entfernt, eine Randregion zu sein, entwickeln sich die zentralasiatischen Republiken zu einem Knotenpunkt eurasischer Vernetzung und Einflussnahme. Handelskorridore zwischen Shanghai und St. Petersburg erleichtern den Transport von Gütern, Kapital und Menschen über Tausende von Kilometern.
Energiepipelines durchziehen Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und weitere Regionen und stellen sicher, dass die enormen natürlichen Ressourcen der Region sowohl den chinesischen als auch den russischen Markt erreichen und sie gleichzeitig in ein breiteres strategisches Netzwerk einbinden.
Gleichzeitig führen digitale „Seidenstraßen“ chinesische Standards für 5G, künstliche Intelligenz und Telekommunikationsinfrastruktur ein und festigen so Pekings technologische Präsenz auf dem gesamten Kontinent [3].
Jahrzehntelang wurde Zentralasien weitgehend als geopolitische Peripherie betrachtet, als Pufferzone zwischen dem anhaltenden Einfluss Russlands und den wachsenden Ambitionen Chinas. Moskau pflegte traditionelle Sicherheitsbeziehungen und wirtschaftlichen Einfluss, während
Peking pflegte Handels- und Investitionsbeziehungen vor allem durch Infrastrukturprojekte. Westliche Mächte engagierten sich dagegen nur sporadisch, meist durch Entwicklungshilfe oder Initiativen zur Terrorismusbekämpfung. Die strategische Bedeutung der Region wurde zwar anerkannt, ihr Potenzial als Zentrum unabhängigen, multipolaren Einflusses blieb jedoch ungenutzt.
Diese Ära neigt sich nun dem Ende zu. Mit der SCO, die sowohl institutionelle Rahmenbedingungen als auch konkrete Projekte bereitstellt, wandelt sich Zentralasien von einer passiven Peripherie zu einem aktiven strategischen Kernland der neuen Ordnung. Seine Städte, Eisenbahnen, Pipelines und digitalen Netzwerke sind nicht nur lokale Vermögenswerte, sondern das Bindegewebe eines eurasischen Systems, das weitgehend unabhängig von westlich dominierten Institutionen operieren soll.
Indem sie Handel, Energie und Technologie in Zentralasien verankern, machen Peking, Moskau und ihre Partner die Region effektiv zu einem zentralen Knotenpunkt in der globalen Machtarchitektur.
Die Auswirkungen sind tiefgreifend. Zentralasien ist nicht länger ein „Hinterhof“ für externe Mächte; es ist ein Dreh- und Angelpunkt geopolitischer Strategie, wirtschaftlicher Integration und technologischer Standardsetzung. Während die SCO ihren Einfluss weiter festigt, unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Region, dass Multipolarität nicht nur ein fernes Ziel ist; sie wird physisch und institutionell aufgebaut, Bahnstrecke für Bahnstrecke, Pipeline für Pipeline und Gigabyte für Gigabyte.
Das Elektro-Yuan- Gambit
Die vielleicht kühnste und folgenreichste Entwicklung in Tianjin war der Aufruf des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, die Verwendung des Yuan bei Energiegeschäften auszuweiten.
Analysten nannten das Konzept schnell „Elektro-Yuan“, ein System, das Chinas digitale Währung mit dem grenzüberschreitenden Handel mit Öl, Gas und Strom verknüpfen soll.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Handelsabwicklungen, die auf Korrespondenzbankgeschäften in US-Dollar basieren, würde der Elektro-Yuan Echtzeit-Transaktionen auf Blockchain-Basis direkt zwischen den SCO-Mitgliedsstaaten ermöglichen und traditionelle Finanzintermediäre umgehen.
Dabei geht es um weit mehr als Bequemlichkeit oder Modernisierung. Sollte der Elektro-Yuan flächendeckend eingeführt werden, könnte er das Petrodollar-System, das seit den 1970er Jahren die Grundlage der US-Finanzdominanz bildet, deutlich schwächen. Die zentrale Rolle des Dollars auf den globalen Energiemärkten ermöglicht Washington seit langem einen außerordentlichen Einfluss auf die internationale Finanz- und Außenpolitik.
Durch die Schaffung eines glaubwürdigen alternativen Zahlungssystems würden Peking und seine SCO-Partner diesen Einfluss untergraben, die Reichweite dollarbasierter Sanktionen verringern und die Fähigkeit der USA reduzieren, geopolitische Ziele durch finanziellen Druck durchzusetzen.
Die Auswirkungen gehen über den Energiesektor hinaus. Ein robustes Elektro-Yuan-Netzwerk könnte die Internationalisierung der chinesischen Digitalwährung E-CNY beschleunigen und anderen Ländern, die sich gegen den Dollar absichern wollen, als Vorbild dienen.
In Verbindung mit von der SCO geleiteten Entwicklungsprojekten und grenzüberschreitenden Handelskorridoren stellt es einen gezielten Versuch dar, die Grundlagen für ein paralleles Finanzsystem zu schaffen, das zu Bedingungen operiert, die für eurasische Partner günstiger sind als für westliche Institutionen.
Die Auswirkungen auf die globalen Märkte könnten tiefgreifend sein. Sollten die SCO-Länder beginnen, Energie, Rohstoffe und Infrastrukturprojekte in Yuan statt in Dollar zu bepreisen, könnte dies die Nachfrage nach US-Währungsreserven verringern, Wechselkurse beeinflussen und globale Investitionsströme neu gestalten. An den Rohstoffmärkten könnten sich Preisanpassungen ergeben, insbesondere bei Öl und Erdgas, da der Elektro-Yuan eine praktikable Alternative zu den heute vorherrschenden Dollar-basierten Verträgen darstellt.
Für Investoren und multinationale Konzerne könnte die Abhängigkeit vom Dollar als Standardwährung für Handel und Finanzen allmählich abnehmen, was neue Risiken und Chancen bei der Absicherung, der Kapitalallokation und dem Währungsmanagement mit sich bringt.
Für die Politiker in Washington und Brüssel ist die Botschaft eindeutig: Die Regeln der globalen Finanzwelt könnten sich unter ihren Füßen verschieben. Ein System, das Handel und Investitionen vom Dollar entkoppelt, würde nicht nur den wirtschaftlichen Einfluss der USA verringern, sondern auch globale Allianzen neu ausrichten und die finanzielle Souveränität zu einem greifbaren Instrument der Staatskunst für Länder wie China, Russland und ihre SCO-Partner machen.
Kurz gesagt: Der Elektro-Yuan ist mehr als ein Finanzexperiment, sondern ein strategischer Schachzug. Er signalisiert, dass es der SCO nicht nur darum geht, die westliche Hegemonie rhetorisch herauszufordern. Sie baut eine Infrastruktur auf, die eines Tages mit den Grundlagen der von den USA dominierten globalen Wirtschaftsmacht konkurrieren oder sie vielleicht sogar umgehen könnte – mit Konsequenzen, die sich auf jeden Winkel des Weltmarkts auswirken.
Indiens pragmatische Absicherung
Die Anwesenheit von Premierminister Narendra Modi beim Gipfeltreffen in Tianjin verlieh dem Treffen noch mehr Gewicht und globale Bedeutung. Indien, das chinesisch geführten Initiativen traditionell skeptisch gegenübersteht, begegnet regionalen multilateralen Rahmenwerken oft mit Skepsis, aus Angst, von Peking oder Moskau in den Schatten gestellt zu werden.
Modis Teilnahme signalisierte einen subtilen, aber bedeutsamen Wandel in Indiens strategischer Ausrichtung: Es setzt auf Engagement statt auf Isolation, was in einer sich rasch entwickelnden multipolaren Welt unerlässlich ist.
In Tianjin einigte sich Neu-Delhi auf konkrete Maßnahmen zur Wiederherstellung des Handels mit China, zur Lockerung der Visabestimmungen und zur Verbesserung der Konnektivität im Rahmen der SOZ. [4]
Diese Schritte zeugen von der Bereitschaft, wirtschaftlichen Pragmatismus von anhaltenden Territorial- und Grenzstreitigkeiten zu trennen, insbesondere in Regionen wie Ladakh und Arunachal Pradesh. Durch die Abschottung dieser Themen signalisiert Indien, dass es bei der wirtschaftlichen und regionalen Integration kooperieren und gleichzeitig seine Sicherheitsbedenken wahren kann.
Für Indien bedeutet das Engagement in der SCO nicht, Partei für Peking oder Moskau zu ergreifen. Vielmehr ist es Ausdruck eines strategischen Absicherungsansatzes: Es mindert die Risiken von Zolldrohungen aus Washington, stärkt die Widerstandsfähigkeit gegen Lieferkettenunterbrechungen und stellt sicher, dass Indien nicht von den entstehenden eurasischen Handels- und Infrastrukturnetzwerken ausgeschlossen werden kann.
Durch seine aktive Teilnahme sichert sich Indien ein Mitspracherecht bei der Gestaltung regionaler Regeln und Normen, anstatt passiver Beobachter eines Prozesses zu bleiben, der die geopolitische Landschaft für Jahrzehnte prägen wird.
Dieser Ansatz steht im Einklang mit Indiens umfassender Außenpolitik der „strategischen Autonomie“, die Flexibilität bewahrt, um zwischen konkurrierenden Machtzentren zu navigieren und gleichzeitig nationale Interessen zu verfolgen. Gleichzeitig pflegt Indien weiterhin robuste Partnerschaften im Rahmen der Quad-Staaten (mit den USA, Japan und Australien) und seine wachsenden bilateralen Beziehungen zu Washington.
In der Praxis bedeutet dies, dass Indien gleichzeitig mit von China geführten Institutionen wie der SCO interagiert und die sicherheits- und technologische Zusammenarbeit mit dem von den USA geführten indopazifischen Block stärkt. Diese zweigleisige Strategie ermöglicht es Neu-Delhi, sich an mehreren Fronten gegen Unsicherheit abzusichern: Sie sichert den Zugang zu eurasischen Märkten und Energiekorridoren, ohne die strategische Ausrichtung mit westlichen Partnern zu opfern.
Der Gipfel in Tianjin spiegelt somit eine einzigartig komplexe indische Strategie wider: weder Konfrontation noch bedingungsloses Bündnis, sondern kalkuliertes Engagement, um sicherzustellen, dass Indien angesichts der sich verändernden globalen Machtstrukturen relevant und widerstandsfähig bleibt.
Durch die Balance zwischen seiner SCO-Teilnahme und den Quad-Verpflichtungen positioniert sich Indien als zentraler Akteur, der konkurrierende Einflusssphären überbrücken und so seine strategische Flexibilität in einer Ära multipolaren Wettbewerbs maximieren kann.
Der Westen am Rande
Der Gipfel von Tianjin war ein Warnschuss: Die Welt dreht sich weiter, mit oder ohne den Westen. Washington und Brüssel verfügen zwar weiterhin über erhebliche wirtschaftliche, militärische und diplomatische Macht, doch ihre Fähigkeit, einseitig globale Bedingungen zu diktieren, schwindet stetig. Jahrzehntelang waren westliche Institutionen wie IWF, Weltbank, NATO und dollarbasierte Finanzsysteme die wichtigsten Einflusshebel und prägten Handel, Entwicklung und Sicherheit weltweit.
Heute jedoch zeigen alternative Rahmen wie die SCO, dass andere Nationen Wohlstand und Sicherheit anstreben können, ohne sich ausschließlich auf westliche Führung zu verlassen.
In ganz Eurasien legen Länder zunehmend Wert auf strategische Autonomie gegenüber starrer Ausrichtung. Sie suchen nach Optionen, die wirtschaftliche Stabilität, Infrastrukturausbau und Energiesicherheit gewährleisten, ohne die politischen Auflagen, die oft mit westlichen Krediten oder Allianzen verbunden sind.
Von Pipelines in Zentralasien bis hin zu digitalen Konnektivitätsprojekten zur Erweiterung des chinesischen 5G-Standards bietet die SCO praktische Alternativen, die gleichzeitig die regionale Integration und multipolare Governance fördern.
Die Botschaft ist klar: Die Regeln und Institutionen des Westens sind nicht mehr das einzige Spiel auf der Welt. Nationen, die diese Neuausrichtung nicht erkennen, riskieren, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und strategisch abgehängt zu werden. Die Teilnahme an neu entstehenden Handelskorridoren, digitalen Netzwerken und Finanzmechanismen wird den Einfluss in Eurasien und darüber hinaus zunehmend bestimmen.
Wer diese Veränderungen ignoriert, könnte feststellen, dass seine Stimme bei globalen Entscheidungen schwindet und sein Zugang zu wichtigen Märkten und Ressourcen eingeschränkt wird.
Darüber hinaus signalisiert der Aufstieg der SCO einen umfassenderen psychologischen Wandel. Jahrzehntelang prägte die Vorherrschaft des Westens die globalen Debatten und weckte Erwartungen hinsichtlich der Machtprojektion.
Tianjin offenbarte eine wachsende Bereitschaft der eurasischen Staaten, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen, westliche Normen in Frage zu stellen und Partnerschaften zu verfolgen, die ihren strategischen Interessen entsprechen, anstatt sich auf die Zustimmung der USA oder Europas zu verlassen. Der Westen kann nicht länger davon ausgehen, dass seine Präferenzen automatisch die Ergebnisse beeinflussen; Einfluss muss nun verdient, ausgehandelt und in manchen Fällen auch erkämpft werden.
Kurz gesagt: Der Gipfel in Tianjin unterstreicht eine zentrale Wahrheit der neuen Ära: Multipolarität ist keine ferne Möglichkeit, sie nimmt hier und jetzt Gestalt an. Um relevant zu bleiben, müssen westliche Politiker ihre Selbstzufriedenheit überwinden und erkennen, dass eine Welt mit der SCO im Zentrum ein Engagement zu Bedingungen erfordert, die zunehmend pluralistisch, flexibel und umstritten sind. Diese Realität zu ignorieren, ist nicht nur kurzsichtig, sondern ein strategisches Risiko.
Eine multipolare Zukunft
Was sich in Tianjin abspielte, war nicht der Beginn eines neuen Kalten Krieges, sondern die Entstehung von etwas weitaus Komplexerem und Folgenreicherem: einer multipolaren Zukunft, in der der Westen nicht länger alleiniger Schiedsrichter über globale Normen, Handel und Sicherheit ist.
Dies ist nicht nur eine Machtverschiebung, sondern eine Transformation der Architektur der internationalen Beziehungen. Zahlreiche Einflusszentren wie Peking, Moskau, Neu-Delhi und die Hauptstädte Zentralasiens gestalten aktiv die Regeln, Institutionen und Wirtschaftsströme, die das 21. Jahrhundert prägen werden. Der Westen, so mächtig er auch bleibt, ist zunehmend ein Akteur unter vielen und nicht mehr der zentrale Entscheidungsträger.
Die unipolare Ära amerikanischer Dominanz, die auf den Kalten Krieg folgte, ging zu Ende und diktierte jahrzehntelang die Bedingungen in Finanzwesen, Handel und Sicherheit. Der Gipfel von Tianjin signalisierte jedoch, dass das nächste Kapitel anders geschrieben werden wird.
Die SCO ist nicht einfach ein Forum für Dialog; sie ist ein bewusster Versuch, einen alternativen Rahmen für regionale und globale Governance zu institutionalisieren, der Handel, Energie, Technologie und Finanzen umfasst. Von der Ausweitung des Yuan im Energiehandel bis hin zu Infrastrukturkorridoren durch Zentralasien schafft die SCO die materiellen und institutionellen Grundlagen einer multipolaren Ordnung, die unabhängig von westlich geprägten Institutionen agieren kann.
Diese neue Realität stellt den Westen vor eine strategische Bewährungsprobe. Können sich Washington und Brüssel an eine Welt anpassen, in der ihre Vormachtstellung nicht mehr vorausgesetzt wird und Einfluss eher ausgehandelt als aufgezwungen werden muss? Oder laufen sie Gefahr, an den Rand gedrängt zu werden und zuzusehen, wie neue Machtzentren die wirtschaftlichen Regeln, geopolitischen Ausrichtungen und technologischen Standards definieren, die das Weltgeschehen in den kommenden Jahrzehnten prägen werden?
Entscheidend ist, dass Multipolarität kein Nullsummenspiel ist, da sie nicht zwangsläufig Konfrontation bedeutet. Sie erfordert aber die Erkenntnis, dass Einfluss, Einflussmöglichkeiten und Legitimität heute verstreut sind. Staaten und Institutionen, die an einer unipolaren Denkweise festhalten, könnten zunehmend an den Rand gedrängt werden.
Staaten und Institutionen hingegen, die in der Lage sind, mit mehreren Machtzentren zusammenzuarbeiten, Risiken abzusichern und sich an alternativen Strukturen zu beteiligen, werden Erfolg haben.
Tianjin war daher mehr als ein Gipfeltreffen; es bot einen Einblick in die sich entwickelnde Weltordnung. Die SCO mit ihrer Mischung aus Wirtschaftsinitiativen, Sicherheitskoordination und Finanzinnovation verdeutlicht, dass das 21. Jahrhundert von Komplexität, gegenseitiger Abhängigkeit und Wettbewerb zwischen mehreren Machtpolen geprägt sein wird.
Die zentrale Frage ist nun, ob der Westen diese neue Realität anerkennt und sich ihr anpasst oder ob er anderen überlässt, die Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Der Autor Prof. Ruel F. Pepa ist ein philippinischer Philosoph mit Sitz in Madrid, Spanien. Als pensionierter Akademiker (Associate Professor IV) lehrte er über fünfzehn Jahre Philosophie und Sozialwissenschaften an der Trinity University of Asia, einer anglikanischen Universität auf den Philippinen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).
Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 06.09.2025




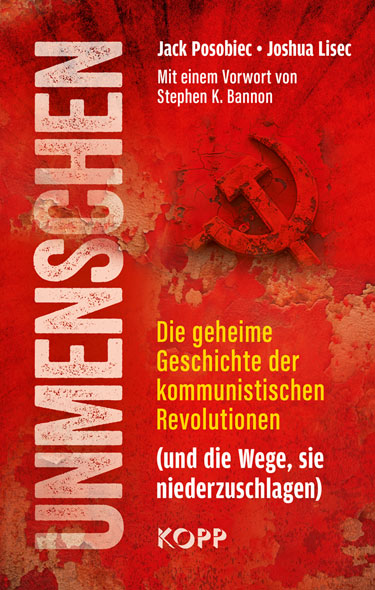


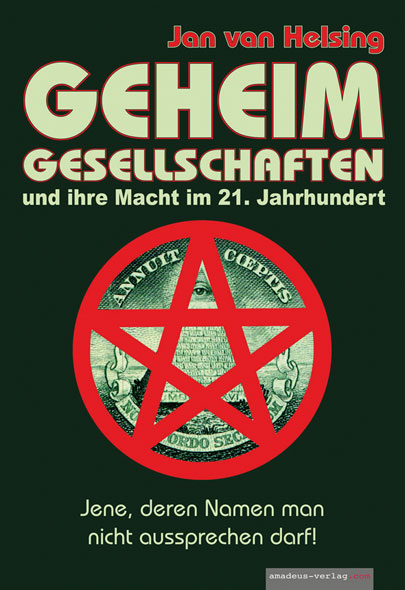
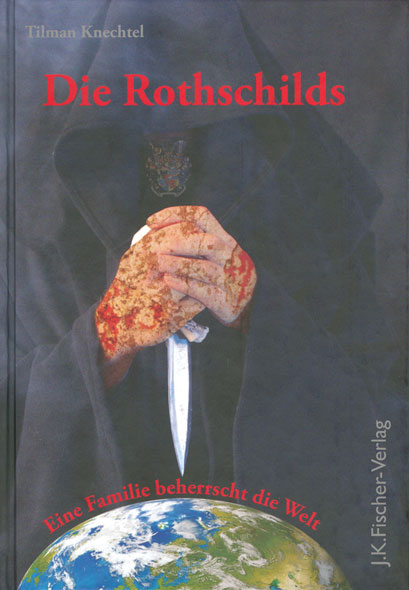

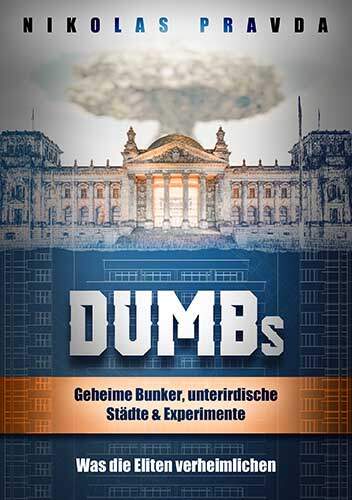
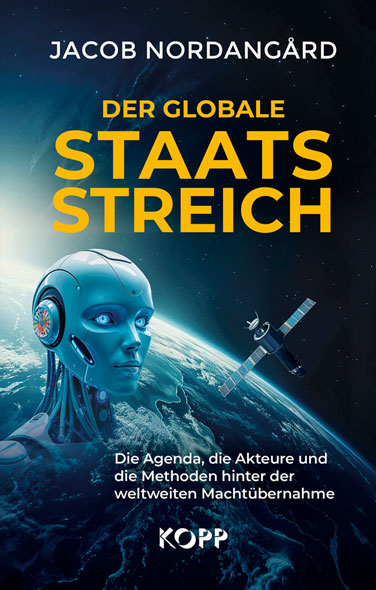

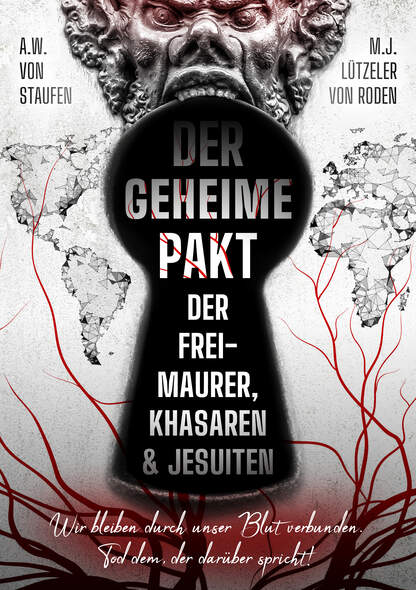
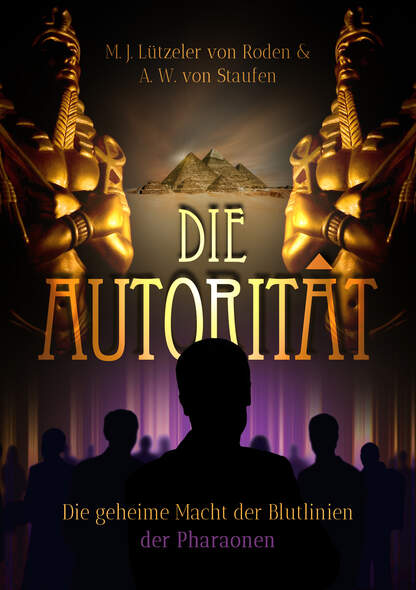
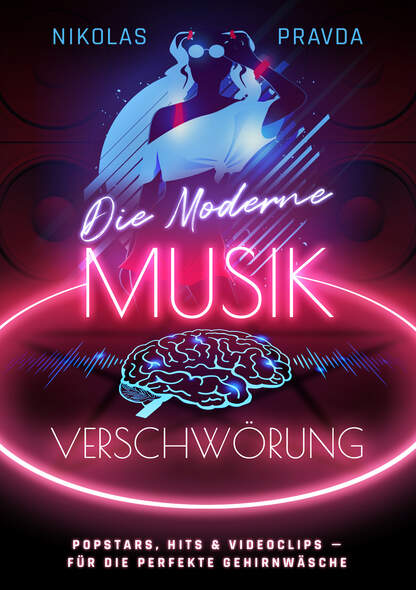
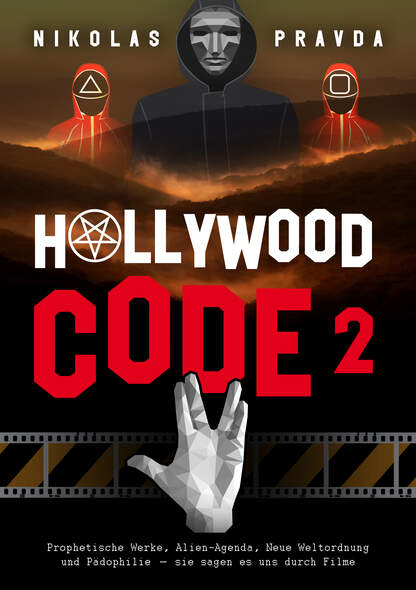

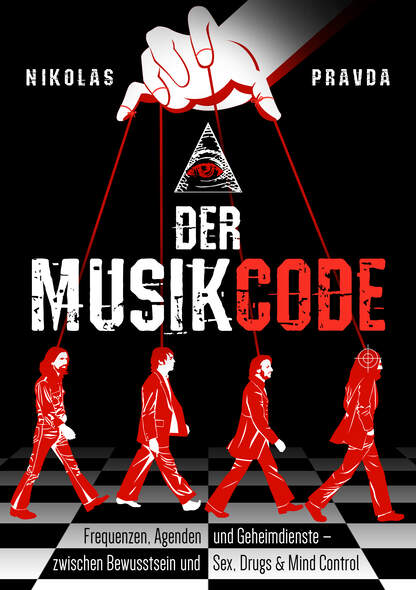
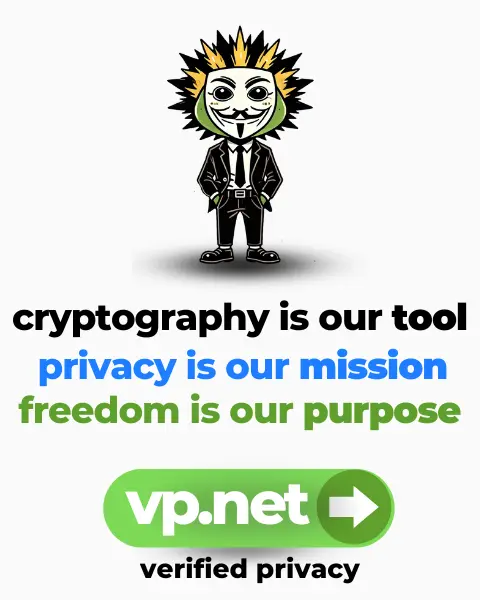
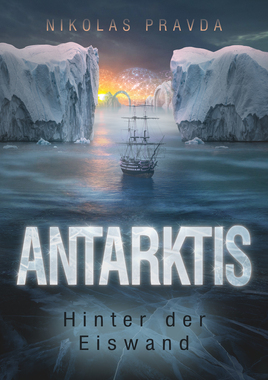
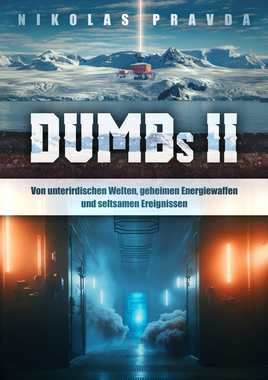

Die Welt wird sich in der gleichen Art und weise verändern, wie es eine Veränderung der Weltordnung durch Jesus-Fische
Auch diese Fische-Welt hatte zu Beginn ca. 200 Jahre lang mit Wiederständen zu kämpfen alle Apostel wurden abgeschlachtet, doch das römische Weltreich hatte gegen das wirkende kosmischen Sternzeichen (Fische) Nichts entgegen zu setzen. Zu Beginn haben sie zwar den Repräsentanten dieser Fische-Macht Jesus entfernt (Kreuzigung), doch die Fische-Weltmacht bahnte sich ihren Weg und verbreitete sich über die gesamte Erde (kath. Kirche) nicht zu verwechseln mit der geistigen Welt welche Jesus versuchte den Menschen zu vermitteln, alle Erklärungsversuche durch Jesus diese Welt zu vermitteln schlugen fehl.
Die Menschen konnten nur die kosmische Sternenkraft wahrnehmen, und die letzten 2000 Jahre gab es keine größere Macht auf der Erde und über alle Menschen der Erde als diese kosmische Sternenkraft der Fische. Was aber heute zu ihrem Ende gekommen ist.
Diese kosmische Sternekraft heute im Wassermann hat die exakt gleiche Kraft wie diese vergangene kosmische Sternekraft der Fische-Jesus (kath.Kirche), diese kosmische neue Sternenkraft des Lebens wird aber von der kath. Kirche abgelehnt, was ihren Untergang begründet. Denn auch sie können diese Neue Welt nicht freiwillig annehmen, also wird es durch Eroberung (Gewalt) kommen.
Haben die Fische die Widder (70 n. Chr.) geschlachtet, denn das römische Reich war 70 n.Chr. das Reiche der FischeWelt in Jesus, dann wurden alle Europäer geschlachtet welche im Denken der Kelten, Wikinger bleiben wollten, dann wurden alle Menschen der Erde geschlachtet welche nicht das Denken der Fische hatten, so wurde das Denken der Fische das weltweit einzige Weltbild.
In gleicher Weise wird auch in 200 Jahren der Wassermann alle Menschen der Erde abschlachten welche im Denken der Fische festhalten. Darum diese Panik in Gaza und Ukraine.
Heute ist das göttliche Denken, das Denken der Urquelle, nur im Denken des Wassermann zu finden, denn die Fische-Welt kam in den Herrschaftsbereich Satans, und in das Denken Satans, was aber immer nach jeweils 2000 Jahren mit jeden Sternzeichen so kommt und auch in Zukunft mit den kommenden Sternzeichen so kommen wird.
Zu Beginn eines Sternzeichen sind 1000 Jahre ohne Satan dann übernimmt für 1000 Jahre Satan die Herrschaft.
Mehr ist das nicht.
Das war beim Widder (abrahamitische Welt) so.
Das war beim Stier Ninive, Ägypten, europäische Kelten so.
Das war beim Zwilling (Adam Eva) so.
Das war beim Krebs (MinoischeWelt der Atlanter) so
Das war beim Löwen so ( Bau der Sphinx Pyramiden so.
und, und, und, ……. das ist alles immer nur eine Wiederholung von Lebenszyklen.
Mehr ist das nicht.
Von daher seh ich das heute Treiben der Menschen gelassen, keep cool running.
Heute denken die Menschen wieder sie könnten gegen Gesetze der kosmischen Ordnung im Universums einen Krieg führen und gewinnen, das ist einfach nur dämlich und dumm.
Der Widder ist der Anfang das erste der Sternzeichen, und der Fisch ist das Ende der Sternzeichen, das letzte Sternzeichen.
Also markiert Jesu den Anfang und das Ende in der Reihe der Sternzeichen, im griechischen als Alpha und Omega bezeichnet.
Zitat Jesus “ die Letzten oben am Himmel (der Sternzeichen), werden die Ersten (die Herrscher über die Menschen) werden.
Hallo. Die frage sollte eigentlich lauten,1 .warum jetzt mulipolar,also in diesem jh.? 2. Wer hat dies alles bezahlt,denn die chinesen konnten vor 60 jahren nicht mal autos bauen(kleines beispiel). 3. Werden Alle, das mitmachen, „wie es denn da heist“ ,du sollst nichts besitzen. Das ist hier,wohl mit der beste satz „gegenseitiger Abhängigkeit und Wettbewerb zwischen mehreren Machtpolen geprägt sein wird. “ Allerdings gab es das auch schon im letzten jh. Ohne ost kein west und andersherum,sollte mal genauuuu betrachtet werden. Denn dies läuft auch schon lange. Wieviele braucht man zum schach spielen? Vieles ,was man auch in diesem artikel wieder erkennt ist. Der westen war immer böse und ist es auch heute noch. Wo kommen denn all die vielen erfindungen her. Und die liste ist sehr lang. Warum wurde der heronsball,nicht schon damals weiterentwickelt.? Die verschönigung einer anderen seite,ist schon grundlegend falsch. Aber so läuft nun mal das spiel,für die massen,und natürlich für einige geistreiche intellektuelle.
Diese Idee „du sollst nichts besitzen“ ist 2000 Jahre alt, damals wurde diese Idee umgesetzt, und wird in der Apg. 4,32 ausführlich beschrieben, hat aber nicht lange gehalten.
Damals hatte diese Idee viele Anhänger, denn die Welt war im Frieden.