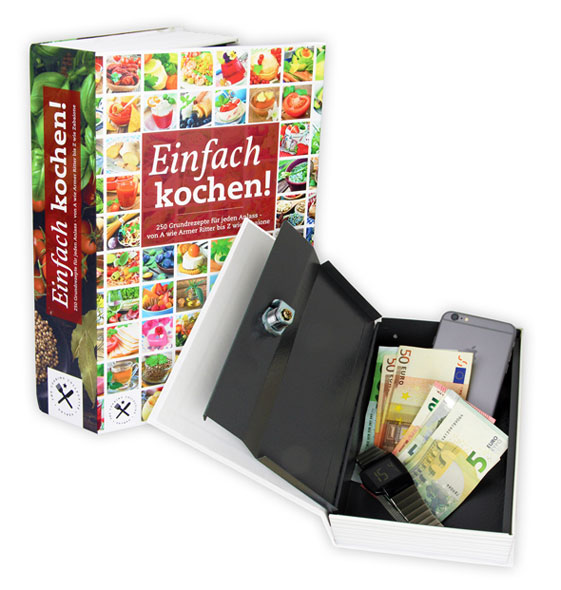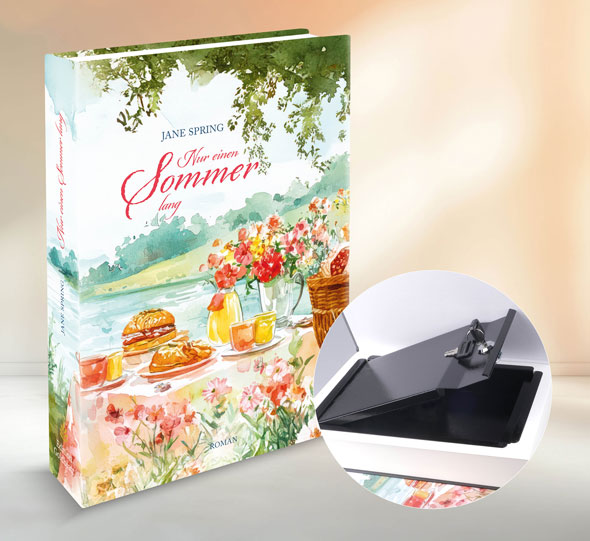Angesichts der sich rapide verschlechternden Haushaltsaussichten glaubt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), endlich eine neue Einnahmequelle gefunden zu haben.
Durch die Abschaffung der seit langem bestehenden Steuervergünstigung für Ehepaare – ein System, das es Paaren ermöglicht, ihr Einkommen zusammenzulegen und ihre Steuerlast zu reduzieren – hofft er, die immer größer werdenden Haushaltslöcher zu stopfen.
Dies ist der vorläufige Höhepunkt einer Debatte über Steuererhöhungen, die weniger darauf abzielt, die Finanzkrise Deutschlands zu beheben., sondern vielmehr darauf, die Politiker vom Druck zu befreien, Strukturreformen durchzuführen.
Eigentlich ist diese Entwicklung keine Überraschung. Die SPD strebt schon seit langem die Abschaffung der Ehegattenzulage an.
Die Maßnahme wird als Reaktion auf das strukturelle Defizit Deutschlands dargestellt, das bis 2029 auf über 170 Milliarden Euro anwachsen soll – vorausgesetzt natürlich, dass die deutsche Wirtschaft nicht noch tiefer in die Rezession abrutscht, als sie es ohnehin schon getan hat.
Ideologie, die sich als finanzpolitische Vorsicht tarnt
Man muss sich fragen, ob die jüngste öffentliche Debatte über die Erhöhung der Erbschaftssteuer nicht nur ein Versuchsballon war, um zu testen, wie viel zusätzliche Belastung die deutsche Bevölkerung zu tragen bereit ist.
Zusammengenommen ergänzen sich beide Initiativen – die höhere Erbschaftssteuer und die Abschaffung des Ehegattenausgleichs – in den Augen der SPD-Ideologen perfekt.
Beide Maßnahmen zielen direkt auf ein Familien- und Generationsmodell ab, das vom Finanzminister als „veraltet” angesehen wird und nun finanziell liquidiert werden soll. (Vgl. tagesschau.de)
Die Sozialdemokraten hatten sich ideologisch schon lange auf diesen Schlag vorbereitet. Und was sollte man auch anderes von einer Partei erwarten, die das klassische Familienmodell weitgehend aufgegeben hat und es gegen identitätspolitische Wählergruppen, wie die Transgender-Bewegung und andere Klientelgruppen eingetauscht hat?
Klingbeil selbst verrät, welche Vision hinter dieser Steueroffensive steckt:
Elterngeld soll Männer dazu ermutigen, mehr Verantwortung in der Familie zu übernehmen. Ohne diese Leistungen für gutverdienende Eltern könnte es wieder üblich werden, dass Frauen zu Hause bleiben. Das wäre ein Rückschlag für die Gleichstellung.
Über rein fiskalische Überlegungen hinaus streben die Politiker der SPD nichts weniger als eine ideologische Umgestaltung der Gesellschaft an.
Mit ihrer Steuerpolitik wollen sie ein neues Gesellschaftsmodell durchsetzen – eines, das den Bürgern echte Wahlmöglichkeiten nimmt, in direktem Widerspruch zu bürgerlichen Traditionen steht und den gesellschaftlichen Grundlagen des Landes zuwiderläuft.
DIW liefert „wissenschaftliche“ Rechtfertigung
Und wie immer, wenn der Staat auf der Suche nach neuen Einnahmequellen ist, steht das Berliner Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bereit.
Die Ökonomen um DIW-Präsident Marcel Fratzscher liefern erneut eine scheinbar wissenschaftliche Rechtfertigung. Sie berechnen auf die letzte Dezimalstelle genau, wie viel die Abschaffung der Ehegattenausgleichsregelung in die Staatskasse spülen würde.
Laut DIW generiert die Abschaffung des Systems zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von 20 bis 25 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Zahl entspricht dem aktuellen Defizit, das durch diese Politik entsteht, da sie vor allem Paaren mit sehr ungleichen Einkommen zugute kommt – wie beispielsweise Einverdienerhaushalten.
Voilà: Die Haushaltslücke wäre zumindest vorübergehend geschlossen. Und das alles ohne schmerzhafte Reformen, Ausgabenkürzungen oder Koalitionsstreitigkeiten.
Für das DIW ist die Ehegattenausgleichsregelung nichts anderes als ein Relikt des Patriarchats. Diese Sichtweise verdeutlicht jedoch das eigentliche Dilemma öffentlich finanzierter Institute:
Im Zweifelsfall beugen sie sich immer der vorherrschenden Ideologie und entfernen sich damit immer weiter von ihrer eigentlichen Aufgabe, der neutralen wissenschaftlichen Analyse.
In Wirklichkeit wäre es ihre Pflicht, auf die eklatanten Ungleichgewichte in der deutschen Finanzarchitektur hinzuweisen – ihre aufgeblähte Bürokratie, ihre erdrückende Steuerlast und ihren übergriffigen Staat, der private Unternehmen stranguliert.
In Einnahmen versinken, Armut beklagen
Vor diesem Hintergrund grenzt die anhaltende Debatte über höhere Steuern an Groteske. Deutschland hat bereits jetzt eine Staatsquote von über 50%.
Die Einnahmen des Bundes sind in den letzten zehn Jahren sprunghaft angestiegen, von rund 311 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 440,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 – ein Anstieg von etwa 42%.
Der Trend beschleunigt sich. Allein im ersten Halbjahr 2025 flossen 273,2 Milliarden Euro in die Berliner Staatskasse, ein Sprung von 5,5% gegenüber dem Vorjahr.
Die Steuereinnahmen, der größte Teil der Einnahmen, stiegen von 282 Milliarden Euro (2015) auf 375 Milliarden Euro (2024). Bis August 2025 hatten sie bereits 247,6 Milliarden Euro erreicht. Der Staat schwimmt buchstäblich im Geld.
Trotzdem erfindet Berlin immer neue Steuern, um Koalitionskonflikte zu entschärfen und Reformen zu verzögern. Für 2026 plant die Regierung eine weitere kräftige Ausgabenerhöhung um etwa 6%. (vgl. bundestag.de) Damit steigen die Gesamtausgaben des Bundes auf rund 530 Milliarden Euro.
Unterdessen wird für die Privatwirtschaft ein Rückgang von 4–5% prognostiziert. Die politische Klasse in Berlin scheint eine einfache Wahrheit vergessen zu haben:
Die Staatseinnahmen hängen letztlich von einer florierenden Privatwirtschaft ab. Anstatt in Zeiten der Depression die Ausgaben zu kürzen, setzt Berlin verstärkt auf Staatismus und Umverteilung.
Ein Angriff auf den sozialen Zusammenhalt
Dass die SPD nun die größte Steuererhöhung seit dem Zweiten Weltkrieg vorbereitet – die bewusst auf die Familie, das Fundament der bürgerlichen Gesellschaft, abzielt – wird die ohnehin schon fragilen sozialen Spaltungen in Deutschland unweigerlich vertiefen.
Die entscheidende Frage ist, ob der Koalitionspartner CDU sich entschlossen zur Wehr setzt und den Plan ablehnt.
Bislang bleiben die Konservativen ausweichend. Im Mai lehnte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann einen Vorschlag der SPD ab und betonte, dass die Eheaufteilung beibehalten werden müsse, sofern sie nicht durch ein umfassenderes Modell der „Familienaufteilung” ersetzt werde, das auch nicht-traditionelle Haushalte abdecke.
Im Juli lehnte die CDU-Frauenunion die Forderung der SPD kategorisch ab und unterstrich den hohen sozialen Wert der Unterstützung familiärer Strukturen. (Vgl. tagesspiegel.de)
Doch wie bei so vielen Themen weiß man nie wirklich, wo die CDU am Ende stehen wird. Wenn man von den Erfahrungen der Vergangenheit ausgeht, könnte die Koalitionsloyalität erneut Vorrang vor den Prinzipien haben.
In diesem Fall steuert Deutschland auf die folgenschwerste Steuererhöhung seit Generationen zu – eine, die Familien schwächen, die Gesellschaft polarisieren und das, was von ihrem wirtschaftlichen Rückgrat noch übrig ist, weiter aushöhlen wird.
Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 06.10.2025